JUCA-Leiterin Maresi Kienzer im Vienna.at-Interview

Vienna.at: Was sind die häufigsten Gründe für Wohnungslosigkeit bei jungen Erwachsenen?
Maresi Kienzer: Was sich bei allen jungen Erwachsenen wie ein roter Faden durch das Leben zieht ist, dass es in der Kindheit und Jugend keine oder wenig Stabilität gab. Das können einerseits Gewalt oder Konflikte in der Familie sein, was zu Fremdunterbringung in einer WG führt. Andererseits kann es auch sein, dass es überhaupt noch nie Kontakt zu den leiblichen Eltern gab und man gleich als Kleinkind fremduntergebracht war. Die jungen Leute haben dann oft von WG zu WG gewechselt. Es kann aber auch sein, dass die Personen schon aus armutsgefährdeten oder armutsbetroffenen Familien kamen, die aus finanziellen Gründen oft umziehen mussten. Dabei war die Familie zwar intakt, aber aufgrund des niedrigen Einkommens gab es oft Delogierungen oder vielleicht auch schon Unterbringungen in der Wohnungslosenhilfe als Kind mit der Familie. Teils haben sie auch in kleinen, desolaten Wohnungen gelebt und haben wegen der Umzüge oft die Schule gewechselt, weshalb die Freundeskreise keine stabilen waren. Und die letzte Gruppe die wir betreuen, sind Personen, die eine Fluchterfahrung hinter sich haben und als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Wien oder Österreich gekommen sind, dann mit 18 Jahren aus diesen WGs raus mussten und so bei uns landen.
Vereinzelt aber doch gibt es auch junge Erwachsene aus wohlhabenden Familien, in denen es jedoch aus diversen Gründen zu Problemen gekommen ist. Dann folgt oft der Bruch mit der Familie oder der Abbruch von Unterstützung dieser. Beispiele hierfür sind etwa ein plötzlicher Tod in der Familie oder Bindungsprobleme durch psychisch erkrankte Eltern.
Seit 40 Jahren können Jugendliche zwischen 18 und 27 Jahren im JUCA ein Dach über den Kopf finden. Im neuen Jahr soll sich einiges ändern. Was genau?
Das JUCA gibt es seit 40 Jahren und es hat sich in dieser Zeit auch schon massiv verändert. Ursprünglich war es ein reines Wohnheim – so wurde es damals noch genannt – für junge Männer. Mit dem Umzug in die Römergasse vor 22 Jahren sind Frauen dazugekommen. Die Zielgruppe hat sich auch verjüngt. Vorher hatten wir eine Zielgruppe von 18 bis 30 Jahren, nun von 18 bis 27 Jahren. Das Wohnhaus war vor 20 Jahren tatsächlich ein sehr hoher Standard im Vergleich zu anderen Wohnungsloseneinrichtungen, weil wir Einzelzimmer und WG-Settings hatten. Das ist für junge Erwachsene durchaus spannend und interessant.

Mit der Zeit haben wir aber auch erkannt, dass es ein diverseres Angebot für junge Erwachsene geben muss und dass dieses Wohnhaus mit 67 Wohnplätzen und 16 Chancenquartiersplätzen, also insgesamt 83 Plätzen im Haus, schon sehr groß ist. Für einige, die mit 18 Jahren zu uns kommen, ist es erschlagend und nicht das richtige Angebot. Sie benötigen viel Aufmerksamkeit und Unterstützung und dafür fehlt es für 83 Menschen an Ressourcen. Daher ist unser Plan, dass wir in ein kleineres Haus ziehen, in dem es nur mehr 35 Wohnplätze geben wird. Diese Wohnplätze sollen dann dafür besser ausgestattet sein, sprich kleine Einzelgarconnieren mit WC, Küche und Bad im eigenen Bereich. Gleichzeitig wollen wir mehr Außen-WGs aufbauen, um keine Plätze zu verlieren. Im zehnten Bezirk haben wir schon jetzt eine Außen-WG mit 12 Plätzen. Wir haben erkannt, dass das für viele das richtige Angebot ist. Manche sagen, dass sie es gerne im JUCA in der Römergasse probieren und dann erst in die Außen-WG übersiedeln wollen. Manche wollen zuerst in die WG und probieren, wie selbstständig sie schon sind.
Seid ihr derzeit voll ausgelastet?
Von den insgesamt 95 Plätzen sind derzeit zwei Plätze frei. Es ist schon so, dass unsere Auslastung immer knapp an die 100 Prozent geht. Auch eine zweite Einrichtung der Caritas, mit der wir kooperieren, die Jugendnotschlafstelle a_way ist immer gut ausgelastet.
Jugendliche ohne Wohnung können also in Wien nur im a_way betreut werden?
Das a_way ist eine Jugendnotschlafstelle – die einzige in Wien. Wenn Jugendliche zu Hause Stress haben, können sie einige Nächte im a_way übernachten. Die ersten Nächte sind anonym, da muss man nicht gleich mit einem Ausweis kommen – das ist für viele wichtig, um diesen ersten Schritt extern Hilfe anzunehmen zu machen. Bei den 14- bis 18-Jährigen ist dann natürlich noch eine Verpflichtung da. Das heißt, man muss das Jugendamt einschalten, wenn die Jugendlichen nicht mehr nach Hause zurückgehen wollen. Jugendliche und junge Erwachsene werden dann je nach Bedarf und Problemlage im a_way verlängert oder an passende Angebote weitervermittelt.
Kommen die jungen Erwachsenen die bei euch betreut werden hauptsächlich von der MA11?
Drei Viertel der jungen Erwachsenen, die zu uns kommen, haben irgendwann in ihrer Jugend mit dem Jugendamt zu tun gehabt. Wir haben einen Teil von jungen Erwachsenen, bei denen die WGs oder die MA11 schon direkt bei uns angefragt hat, ob sie kommen können. Oft kommen die jungen Erwachsenen dann doch erst mit achtzehneinhalb oder 19, weil sie in der Zwischenzeit doch noch bei Freunden unterkommen konnten oder doch das ganze soziale Umfeld noch durchlaufen sind, weil sie von einem stationären Setting mit starken Strukturen nicht ins nächste wechseln wollten. Sie schlagen dann quasi erst auf, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
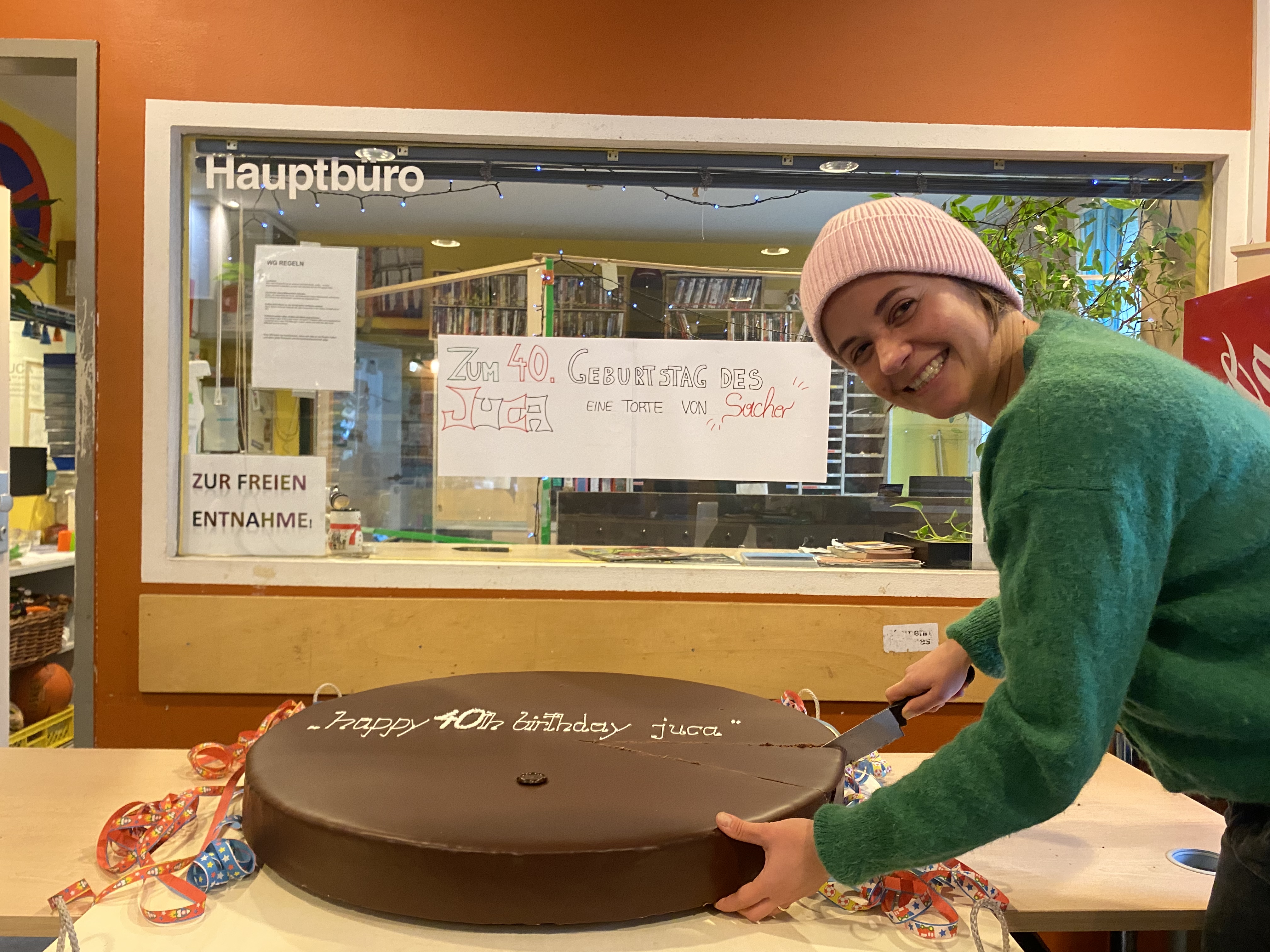
Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist nicht die Wohnungslosenhilfe zuständig?
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden unterstützt bis zum 18. Lebensjahr oder vereinzelt, aber zu selten, verlängert. Gelingt die Verselbstständigung nicht, dann gibt es nur die Option in die Grundversorgung zurück oder erstmals zu kommen und dann hängt es mit dem Aufenthaltstitel und dem Einkommen zusammen, ob man Anspruch darauf hat, in die Wohnungslosenhilfe aufgenommen zu werden. Die Grundversorgung wäre und ist meist ein Rückschritt in der Biographie dieser Menschen.
Benötigt man einen Aufenthaltstitel?
Um in der Wohnungslosenhilfe einen fixen Platz zu bekommen, benötigt es eine Gleichstellung zu Österreicher*innen.
Wie bringt man dann beim JUCA Stabilität in den Alltag der jungen Menschen?
Ich sage immer allen Kolleginnen und Kollegen und auch allen Mitarbeiter*innen, die neu im JUCA beginnen: Es muss im Fokus stehen, dass man wirklich Interesse daran hat mit jungen Menschen zu arbeiten. Und das muss mehr sein als sich für das Alter zu interessieren oder auch gern in Clubs zu gehen, sondern man muss schon einiges aushalten können. Wir setzen permanente Beziehungsangebote, die auch immer wieder abgeblockt werden, weil es den jungen Erwachsenen egal ist, wenn es zu Konflikten kommt, oder sie es durch die vielen Abbrüche in der Biographie nicht besser erlernt haben auf diese Beziehungsangebote einzugehen. Unsere jungen Erwachsenen reiben sich recht stark an uns. Das ist auch dem Alter geschuldet, weil sie sich auch erst einmal selber erkennen und ausprobieren müssen oder wissen müssen, wo ihre Grenzen sind. Es muss gelernt werden, wie man mit Krisen und Konflikten umgehen kann. Es ist notwendig, dass wir permanent Möglichkeiten schaffen, damit die jungen Menschen mit uns in Interaktion treten können. Wir haben Beschäftigungsangebote wie das JUCAN und die JUCANTINE, bei denen man sich untertags erstens Taschengeld verdienen kann, aber auch gemeinsam etwas herstellen kann. Das JUCAN ist eine Textil- und Filzwerkstatt, in der Produkte aus Filz hergestellt werden und die JUCANTINE ist eine Lernküche.

Wie sieht das konkret aus, wenn jemand zu euch ins JUCA kommt und einen Platz braucht?
Es gibt mehrere Optionen. Eine Person ruft an oder schreibt ein E-Mail und sagt uns, sie steht auf der Straße. Die erste Möglichkeit ist es, dass die Person in ein Chancenquartier kommt. Wir betreiben ein solches und ab Jänner sollte ein Chancenquartier gezielt für junge Erwachsene vom neunerhaus eröffnen (Anmerkung: hat bereits offen, aber derzeit noch in Startphase). Das wird die Situation auch etwas erleichtern, weil wir – neben dem a_way – bisher die Einzigen waren, die mit dieser Zielgruppe zu tun haben. Ins Chancenhaus kann man in akuten Krisen kommen und für drei Monate bleiben. Da geht es nur darum, zu sehen, ob die Wohnungslosenhilfe die richtige Richtung ist, oder ob nicht wirklich die eigene Wohnung der richtige Platz wäre und sein kann. Wir sehen uns an, ob es nur um eine Wegweisung von zu Hause geht und was die Hintergründe sind. Dann haben die jungen Erwachsenen drei Monate Stabilität und Ruhe, ohne, dass man da viel weiterbringen muss.
Option Nummer zwei ist, wenn es wirklich um einen fixen Platz in der Wohnungslosenhilfe geht, dass die Person zur Wohnungslosenhilfe in der Lederergasse gehen muss. Das ist in Wien leider ein wenig bürokratisch und nicht so niederschwellig, wie wir uns das wünschen. Dort muss man einen Antrag stellen. Es wird geprüft, ob die Person förderwürdig ist. Dazu gibt es unterschiedliche Kriterien vom Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe: Man muss ein gewisses Einkommen haben, man muss den Lebensmittelpunkt in Wien haben, man braucht einen gewissen Betreuungsbedarf und nicht nur einen günstigen Wohnraum - dann gibt es eine Bewilligung. Die Wartezeiten auf diese Plätze dauern allerdings momentan viele Monate.
Wie lange dauert ein solches Verfahren?
(lacht, wird dann ernst) Das kann ich jetzt schwer beantworten, das kann schon ein paar Wochen auch dauern. Das hängt natürlich auch ab, wie die Ressourcen beim Beratungszentrum vorhanden sind und wohin vermittelt wird. Wir zählen zum stationär betreuten Wohnen und dann gibt es noch das mobil betreute Wohnen „Housing First“. Dabei ist man in einer eigenen Wohnung und wird mobil betreut. Und da muss man tatsächlich länger warten bis eine Wohnung verfügbar ist.
Beim stationär betreuten Wohnen dauert das Verfahren nicht so lange. Die Bewilligung ist oft schon da, aber man muss auf den Platz warten, wenn die Einrichtung voll ist.
Wo übernachten die jungen Leute, während sie auf die Bewilligung warten?
In Chancenquartieren oder im Winter in Winternotquartieren. Das ist natürlich auch nicht sehr schön, weil das einfach große Notquartiere sind, in denen man mit mehreren Leuten nächtigt. Oder die jungen Erwachsenen reizen noch das eigene Umfeld aus und können bei Freunden oder Freundinnen von einer Couch zur nächsten wandern. Auch in U-Bahnen oder Shopping-Centers schlafen die jungen Leute über Nacht. Unter Tags sind sie in Tages- oder Jugendzentren.
Sie haben vorher erwähnt, dass auch das Einkommen betrachtet wird, wenn man einen Antrag auf Wohnungslosenhilfe stellt, aber oft haben junge Leute kein Einkommen. Was geschieht dann?
Das Beratungszentrum gibt in solchen Fällen eine Bewilligung und das Einkommen muss nachgereicht werden oder zumindest muss man nachweisen, dass man bei der MA40 schon um Mindestsicherung angesucht hat oder beim AMS war. Dann dauert es relativ lange. Es kann bis zu drei Monate dauern, bis das alles bewilligt ist. Das Beratungszentrum gibt dann seine Bewilligung schon vorher, verlangt aber, dass diese Dinge nach drei oder fünf Monaten nachgereicht werden. Sollte man keinen Anspruch auf ein Einkommen haben und das wurde beim Beratungszentrum übersehen, dann wird es schwierig. Denn dann wird der Wohnplatz aberkannt. Aber das passiert so gut wie nie. In Härtefällen kann es aber dazu kommen, dass die Person nicht in der Lage ist, sich ein Einkommen zu generieren. Dann erreicht man die Förderkriterien nicht und wird abgelehnt. Diese Fälle können dann sehr lange dauern, da es oft erst um die Stabilisierung der (psychischen) Gesundheit, dem Organisieren von Dokumenten usw. geht.

Es ist oft so, dass junge Erwachsene ihre Ausbildung abgebrochen haben. Wie helft ihr ihnen?
Das ist tatsächlich relativ häufig. Drei Viertel unserer Bewohnerinnen haben maximal einen Pflichtschulabschluss und danach alles Mögliche ausprobiert, aber nichts abgeschlossen. Der erste Schritt ist dann, dass sie MA40 und AMS nutzen. Mittlerweile gibt es auch das U25, das sich gezielt mit der MA40 und dem AMS für diese Altersgruppe zusammengeschlossen hat, damit sie in einem Gebäude sind und überschneidend unterstützen können. Dann denken wir mit den jungen Erwachsenen durch, was sie gerne machen würden und versuchen sie zu den Terminen zu begleiten, damit sie dort dann schaffen zu sagen, was sie. Es gibt viele Angebote, aber die AMS-Termine dauern zumeist 15 Minuten und die AMS-Berater*innen haben dann oft schon etwas vorbereitet - das ist oft irgendein unpassender Kurs. Und dann gefällt der Kurs dem jungen Erwachsenen nicht, er bzw. sie geht nicht hin und die Abwärtsspirale geht von vorne los.
Was sind Themen von jungen Wohnungslosen?
Wir haben in unserem Aufnahmeblatt oder im Erstgespräch immer die Frage: Was wünschst du dir? Ich finde es immer wieder überraschend, dass sich junge Menschen am meisten wünschen, was unsere Gesellschaft vorlebt. Also Job, Familie und Eigenheim. Das sind die Ziele, die sie erreichen wollen. Wir brechen es dann auf die Möglichkeiten herunter, die sie haben. Ein Thema, das die Bewohner*innen sonst mitnehmen, ist das Einkommen. Gerade in Wien ist es so, dass die unter 25-Jährigen, wenn sie Mindestsicherung beziehen, weniger bekommen, als die über 25-Jährigen. Das soll der Ansporn sein, dass sie einen AMS-Kurs machen und dann bekommen sie den vollen Betrag. Sonst bekommen sie nur drei Viertel des Geldes. Der grundsätzlich richtige Gedanke funktioniert leider für die Zielgruppe nicht, da sie durch Kürzungen nicht mehr, sondern weniger motiviert werden.
Haben sich junge Menschen in der Obdachlosigkeit die Zukunft verbaut?
Nein definitiv nicht. Was ich schon glaube, ist, dass es definitiv schwerer ist, einen guten Weg hinaus zu finden, als wenn man die Stabilität von der Familie oder vom Freundeskreis hat. Was definitiv der Fall ist: Je länger man tatsächlich obdachlos auf der Straße ist, desto schlechter ist es. Desto eher sind gesundheitliche Probleme Thema und desto kürzer ist die Lebenserwartung. So, wie man sagen kann, dass armutsgefährdete Personen eine schlechtere Gesundheit oder Lebenserwartung aufweisen, weil der Körper die schlechte Ernährung, den Stress und die ganzen Einflüsse schwer verarbeiten kann. Was wir tun, egal wie unsere Bewohner*innen ausziehen und was ihr Werdegang nach dem JUCA ist, ist, dass wir versuchen ihnen einen Rucksack zu befüllen mit Handwerkszeug, damit sie wissen, wo sie sich hinwenden können, was sie tun können, damit sie ein wenig Know-how haben, wo Netzwerke sein können und für sie neue Netzwerke aufbauen können. Und wir versuchen auch die Hemmschwellen abzubauen, damit sie wissen, dass es ok ist, sich Hilfe zu holen. Glücklicherweise sehen wir Erfolge und es gelingt vielen. Wir sind davon überzeugt, dass sie das allein kaum hätten schaffen können und unser Angebot daher wichtig ist.
Spenden können Sie an die Caritas unter:
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000
Kennwort: JUCA
Spendenmöglichkeiten finden Sie aber auch online hier.
Auch Sachspenden sind beim JUCA jederzeit willkommen. Mehr Infos hier.
(cor)





