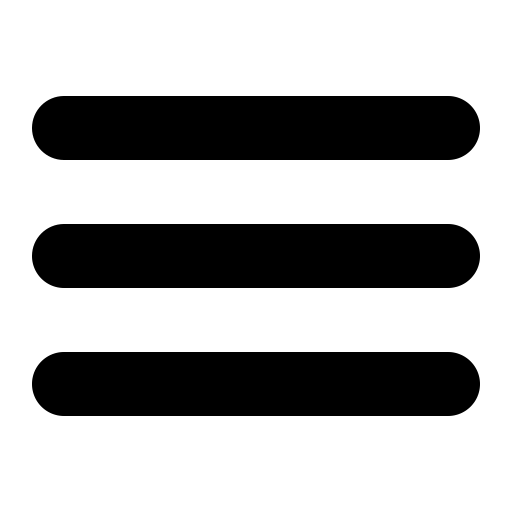The Act of Killing: Joshua Oppenheimer im Interview

APA: Wie kamen Sie auf einen Völkermord, von dem die Welt nichts zu wissen scheint?
Joshua Oppenheimer: Auch ich wusste nichts über den Genozid in Indonesien und bin mit meiner Co-Regisseurin Christine Cynn 2002 bei Dreharbeiten auf einer indonesischen Plantage darauf gestoßen. Die Arbeiter wollten damals eine Gewerkschaft gründen, hatten aber zu große Angst, da ihre Großeltern 1965 als Mitglieder einer mächtigen Plantagengewerkschaft als Sympathisanten von Kommunisten verurteilt, in Konzentrationslager geworfen und schließlich umgebracht wurden. Ihre Enkel hatten Angst, das könnte wieder passieren, also baten sie uns, einen Film über die Furcht zu machen, mit der sie heute inmitten der Täter von einst leben.
Mit welchen Hürden hatten Sie daraufhin zu kämpfen?
Oppenheimer: Als die Armee von unserem Vorhaben erfuhr, hielt sie uns davon ab, mit Überlebenden zu sprechen. Also sagten diese: “Wenn wir nicht reden dürfen, geht und filmt die Nachbarn in den Dörfern, in denen die Mörder leben. Vielleicht können sie sagen, wie unsere Verwandten umgekommen sind.” Alles, was die Menschen wussten, war, dass ihre Familienmitglieder entführt wurden und nie wiederkamen. Anfangs drehte ich sehr vorsichtig, stellte den Männern allgemeine Fragen über ihre Jugend, ihren Beruf. Zu meinem Erschrecken und Schock rückten sie alle sofort mit diesen prahlerischen, grauenvollen, detaillierten Erzählungen der Morde heraus, erzählten davon vor ihren Ehefrauen, Kindern, Enkelkindern. Dieser Gegensatz zwischen Überlebenden, die nicht reden durften, und Tätern, die damit prahlten und derart Belastendes zutage brachten, gab mir das Gefühl, als käme ich 40 Jahre nach dem Holocaust nach Österreich oder Deutschland und die Nazis seien noch an der Macht.
Wann gerieten Sie an Anwar Congo, dem exemplarischen und zentralen Protagonisten des Films?
In den nächsten zwei Jahren filmte ich jeden Täter, den ich finden konnte, bis ganz rauf in der Befehlskette, am Land und in der Stadt. Anwar war der 41. Täter, den ich drehte, und auch er prahlte mit den Morden und demonstrierte spontan, wie er diese ausgeübt hatte. Am ersten Tag nahm er mich mit auf das Dach, auf dem er Hunderte Menschen getötet hatte. Zwar hatte ich schon nach dem zehnten gefilmten Täter realisiert, was damals passiert war. Nun aber musste ich verstehen, warum sie so damit prahlen und für wen. Also habe ich Anwar und andere offen damit konfrontiert, dass sie an einem der größten Massenmorde der Geschichte beteiligt waren und ich wissen will, was das ihnen und der Gesellschaft bedeutet. Sie wollten und sollten mir zeigen, wie es passiert ist.
Die Methode des Films war kein Trick, die Männer dazu zu bekommen, sich zu öffnen, sondern eine Antwort darauf, dass sie sich geöffnet hatten. Anwar zu sehen, wie er auf diesem Dach scheinbar sorglos den Cha-Cha-Cha tanzt, zeigt die Leugnung der moralischen Tragweite seiner Taten. Damit streitet er nicht die Fakten ab, sondern die Bedeutung. Als er sagte, er habe getanzt, getrunken und Drogen genommen, um zu vergessen, was er getan hat, wurde mir klar, dass das Prahlen möglicherweise kein Zeichen von Stolz war. Diese Männer wissen, dass sie etwas Falsches getan haben, versuchen sich aber krampfhaft vom Gegenteil zu überzeugen, damit sie morgens keinen Mörder im Spiegel sehen.
Am Ende sehen wir Anwar, wie er auf ebendiesem Dach unter der Last zusammenbricht. Wann beobachteten Sie den Punkt, an dem seine Fassade zu bröckeln anfing?
Zeichen dafür gab es von Anfang an, er schien besessen und verfolgt von dem Bild, Hunderte beim Sterben gesehen zu haben; sein Schmerz war nahe an der Oberfläche. Spannend war zu sehen, ob er das beim Anblick der nachgestellten Szenen realisieren würde. Als ich ihm das erste Material zeigte, wirkte er verstört, konnte es aber nicht zugeben und kritisierte stattdessen seine schauspielerischen Fähigkeiten und die Hose, die er in den Aufnahmen trug. Film ist dann ein großartiges Medium, wenn Menschen das, was sie sagen, selbst nicht glauben. Der rote Faden, der sich durch “The Act of Killing” zieht, ist die Evolution von Anwars Zweifeln. Man hört es zwischen den Zeilen, sieht es in seinem Gesicht. Doch erst als seine Albträume zur Sprache kamen, konnten wir offen über seine Reue sprechen.
Der Großteil der Crew wird im Abspann als “anonym” geführt. Hatten Sie während der Dreharbeiten jemals das Gefühl, in Gefahr zu sein?Ich wusste, dass die hochrangigen Militärs und Politiker den Film hassen würden und uns das bis zu einem gewissen Grad in Gefahr bringen könnte. Daher war von Anfang an klar, dass die indonesischen Mitarbeiter anonym bleiben und von einem weit entfernten Teil des Landes kommen sollten. Es gab brenzlige Momente während des Drehs, etwa als ein Militäroffizier bei der Nachstellung eines blutrünstigen Massakers im Wald “Cut” rief, weil er Sorge hatte, wie er rüberkam. Schließlich änderte er seine Meinung, weil ihm bewusst war, dass ein abschreckendes Image für ein System der Unterdrückung hilfreich sein kann. (APA)