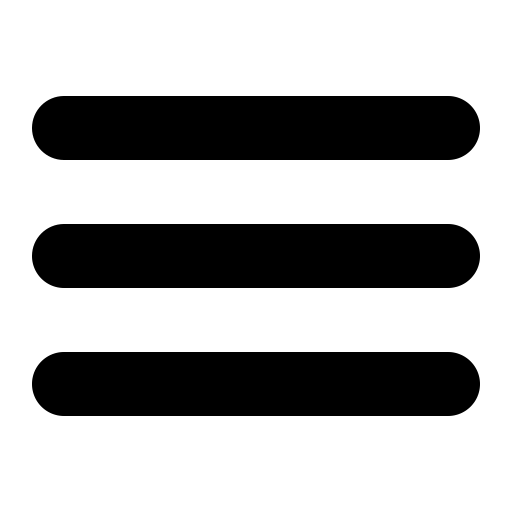Vorzugsstimmen sind die Möglichkeit des Wahlbürgers, neben Ankreuzen einer Partei auch den Namen eines Kandidaten dieser Partei auf den Stimmzettel zu schreiben. Der Wähler hätte damit neben der Entscheidung für eine Partei wenigstens noch ein zweites kleines Rädchen, an dem er drehen kann, um die Zukunft des Landes zu beeinflussen. Ansonsten ist er ja dann ohnedies wieder fünf Jahre irrelevant und kann nur ohnmächtig zusehen, was die gewählten Politiker aus einem angeblichen Mandat machen. Dabei hat dieses in Wahrheit aus einem Bleistiftkreuz neben ein paar Buchstaben bestanden (Schon das Wort “Mandat” ist ja eine Manipulation: Wer wissen will, was “Mandat” wirklich bedeutet, sollte es sich bei einem Rechtsanwalt anschauen; dort ist es eine sehr kurze Leine, nach der sich der Anwalt zu orientieren hat).
Alle Forderungen nach einer echten direkten Demokratie, also nach erzwingbaren und verbindlichen Volksabstimmungen, sind ja bisher immer in den Schaumgummiwänden der Machtaristokratie hängengeblieben. Von den Parteien bei der Einführung groß beklatschte Instrumente wie Petitionen oder Volksbegehren haben sich längst als bloße Bürgerverhöhnung entpuppt. Und die Ergebnisse parteiinterner Urabstimmungen sind bei Rot (Ceta-Unterzeichnung) wie Grün (Hochhaus neben dem Konzerthaus) in den vergangenen Monaten überhaupt brutal ignoriert worden. Beide Parteien haben dann jeweils das Gegenteil gemacht.
Da wundert es doch ein wenig, dass SPÖ-Chef Kern jetzt anzukündigen wagt, dass er ganz sicher wieder eine Partei-Urabstimmung machen werde, nämlich diesmal über den Abschluss einer Koalition. Und dass er sich diesmal ganz, ganz sicher auch an das Ergebnis halten werde. Nun ja.
Die Vorzugsstimmen
Aber zurück zur zweiten Möglichkeit eines echten Demokratieausbaus, zu den Vorzugsstimmen. Sebastian Kurz, der neue starke Mann der Volkspartei, hat durchgesetzt, dass seine Partei bei der Verteilung der Mandate die Vergabe der Vorzugsstimmen deutlich stärker berücksichtigt, als der Gesetzgeber das vorsieht. Das ist zweifellos lobenswert. Ist doch die vom Gesetzgeber festgelegte Vorzugsstimmenhürde so hoch, dass es fast ausgeschlossen ist, dass ein weiter hinten auf dem Wahlzettel stehende Kandidat auf diesem Weg ins Parlament kommt.
Der Kurz-Schritt fällt umso mehr auf, als keine der anderen Parteien bereit ist, die Mitsprache der Bürger ähnlich aufzuwerten. Dabei wird in diesem Wahlkampf sonst jeder Unsinn, den eine Partei sagt, – etwa die sauteure und auf Kosten der Allgemeinheit gehende Abschaffung des Pflegeregresses auch bei wohlhabenden Menschen – sofort von allen anderen nachgebetet.
Grüne und Neos führen zwar parteiintern Vorwahlen durch, aber die sind kompliziert und laufen an den allermeisten Wählern dieser beiden Kleinparteien völlig vorbei (an den übrigen sowieso). Und außerdem behalten die Parteiapparate immer einen wesentlichen Teil der Kontrolle über die Kandidatenliste. Und fortschrittlich demokratische Vorzugsstimmensysteme propagieren auch sie nicht.
Offenbar halten die Parteien den Wähler für zu blöd oder bösartig, sodass sie nicht bereit sind, ihm die Personalentscheidung über die Parlamentarier zu überlassen. Oder aber es gilt die Vermutung: Wenn es wirklich um etwas geht, dann sind die Apparate machtgierig wie eh und je.
Dabei kommen ja ohnedies nur von der jeweiligen Parteileitung ausgesuchte und genehmigte Menschen überhaupt ins Vorzugsstimmenrennen, welcher Art immer. Dabei würden sich mit Sicherheit alle Kandidaten auf dem Stimmzettel viel mehr anstrengen und viel mehr Wähler für sich und damit ihre Partei ansprechen, wenn es ein realistisches Vorzugsstimmensystem gäbe.
Aber die Gesetzeslage macht dieses de facto zu totem Recht. So müsste man 7 Prozent aller auf eine Partei gültig entfallenen Stimmen für sich gewinnen, um auf einer Bundesliste ein Mandat zu erhalten; und in einem Regionalwahlkreis sind es sogar 14 Prozent.
Da ist ein Totozwölfer leichter zu schaffen, als solcherart ins Parlament zu kommen. Daher lassen fast alle Kandidaten die Bemühungen um Vorzugsstimmen gleich ganz schleifen und hoffen einfach darauf, dass sie von ihrer Partei an wählbare Stelle gerückt werden. Um dann der Partei fünf Jahre lang dankbar und ergeben sein zu müssen.
Kurz-Modell vs. Niederösterreich und Burgenland
Da ist jedenfalls das Kurz-Modell deutlich besser als alles, was die anderen Parteien tun. Dennoch ist eigentlich auch dieses enttäuschend und wird die Hauptvorteile eines Vorzugsstimmensystems verfehlen. Denn es ist geradezu typisch österreichisch: mit halben Mitteln zu halben Zielen …
Kurz hat die vom Gesetz festgesetzten Hürden genau halbiert. Diese liegen jetzt für schwarze Kandidaten bei 3,5 Prozent bis 7 Prozent, je nach Wahlkreisart. Die Hürden sind damit zwar deutlich niedriger, aber dennoch so hoch, dass ein Vorzugstimmenerfolg nicht gerade leicht und wahrscheinlich ist.
Die VP-Bundesländer Niederösterreich und Burgenland zeigen, dass es auch anders ginge (die Steiermark-VP macht wiederum sinnloserweise ein Mittelding zwischen diesen Vorbildern und dem Bundesmodell). Nur diese beiden VP-Länder waren mutig genug, ein echtes Vorzugsstimmensystem einzuführen: Dort ist einzig die Zahl der Vorzugsstimmen pro Kandidat entscheidend. Wer am meisten Vorzugstimmen hat, bekommt das erste Mandat, wer am zweitmeisten hat, das nächste Mandat. Und so weiter.
Dieses System ist einfach und braucht keine höhere Mathematik. Es ist gerecht, demokratisch und sinnvoll. Es bewährt sich schon seit langem in Niederösterreich, aber auch in Italien, wo man es etwa in Südtirol seit Jahrzehnten auch ohne Sprachkenntnisse genau studieren hätte können.
Daher ist eigentlich rätselhaft, warum Kurz, der oft in Südtirol ist, es nicht auch bundesweit einsetzt. Hat er Angst vor der eigenen Courage? Vertraut auch er dem Wähler nicht wirklich? Hat er es trotz seiner neuen vieldiskutierten Macht parteiintern nicht durchgebracht, weil die Apparate in sieben Bundesländern doch nicht ganz entmachtet werden wollen? Will man auf Grund eines solchen halbgaren Projekts nachher sagen können: „Die Leute wollen es halt offenbar eh nicht!“, damit man künftig wieder unter sich bleiben kann? Oder hat Kurz – das wäre die positivste, aber unwahrscheinlichste Interpretation – so viele gute Experten fürs Parlament im Köcher, die aber zu unbekannt sind, um sich bei den Vorzugsstimmen durchzusetzen (schön wäre das ja vor allem angesichts der jetzigen Abgeordnetenqualität)? Oder fürchtet Kurz um sein zweites, mit den Vorzugsstimmen konkurrierendes Wahllistenprojekt, nämlich den „Reißverschluss“, also die abwechselnde Reihung von Männer und Frauen?
Der Unsinn Reißverschluss
Dieses zweite Projekt ist und bleibt jedoch ein Unsinn. Und es wäre für die ÖVP selbstbeschädigend und dumm, wenn ausgerechnet deshalb ein echtes Vorzugsstimmensystem in sieben Bundesländern verhindert worden wäre.
Der Reißverschluss ist vor allem deshalb ein Unsinn, weil weder Kurz noch die anderen Parteien, die es praktizieren, die Konsequenzen durchdacht haben: Denn wenn man einmal mit Quoten (Vorzugsstimmen sind ja nichts anderes) anfängt, dann gibt es absolut kein Argument gegen das Verlangen, auch für zahllose andere Gruppen Quoten einzuführen.
Dann bräuchte es auch Moslem- und Protestantenquoten (wird bei Moslem-Organisationen immer öfter verlangt);
dann bräuchte es Schwulenquoten (sind diese doch die Lautesten beim ständigen Schreien, dass sie diskriminiert würden);
dann bräuchte es Quoten für Transgender-Menschen (das hat eine „Presse“-Kolumnistin unlängst schon in vollem Ernst verlangt);
dann bräuchte es Quoten für Verheiratete und Unverheiratete (deren Interessenlagen divergieren ja oft viel mehr als etwa die zwischen Ehepartnern);
ebenso zwischen Eltern und Nichteltern;
dann bräuchte es Berufsquoten (was bei der ÖVP natürlich hieße: weniger Bauern, Beamte und Kammerfunktionäre);
dann bräuchte es Quoten für Auslandsösterreicher;
dann bräuchte es Quoten für jede Alterskohorte (um die Dominanz der 40- bis 60-Jährigen zu zertrümmern, um so viel Pensionisten ins Parlament zu bringen wie deren Anteil entspricht).
Und so weiter. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Jede dieser Quoten kann argumentativ mindestens gleich gut begründet werden wie die Geschlechterquote. Das Absurde ist: Gerade die ÖVP hatte ja lange Quoten, nämlich den Proporz zwischen Bünden und Teilorganisationen. Dieser war ja im Prinzip nichts anderes als eine berufsständische Quote. Er war nur immer viel flexibler gehandhabt als das jetzige mechanische Reißverschlusssystem.
Trotzdem ist er von allen Medien heftig getadelt worden. Die gleichen Medien haben jedoch skurrilerweise jetzt auf jede Kritik am starren Reißverschlusssystem verzichtet. Aber gut: Warum soll man von den Medien Denken verlangen können, wenn es die Parteien auch nicht tun?
Bei Quoten bleibt halt nur eines auf der Strecke: nämlich die Möglichkeit, tolle und interessante Persönlichkeiten ganz ohne Rücksicht auf ihre Herkunft und Quotenzugehörigkeit fürs Parlament aufzustellen.
Noch einmal sei betont: Wenn ein Unsinn halbiert wird (wenn der Reißverschluss durch die Flexibilisierung des Vorzugsstimmensystem gemildert wird), ist er zwar nur noch halb so groß. Das ist vor allem dann positiv zu bewerten, wenn alle Konkurrenten nicht einmal zum Halbieren der hohen Vorzugsstimmenhürde bereit sind. Aber es bleibt trotzdem traurig, wenn auch die ÖVP in der vielleicht größten Aufbruchsphase ihrer Geschichte ohne nachvollziehbaren Grund nur zu halben Schritten bereit ist.
PS: Ganz auf Geschlechterquoten scheint nur die FPÖ zu verzichten – diese verzichtet dafür aber auch leider total auf alle Vorzugsstimmenregeln. Dafür spricht sie sich recht konsequent für eine Direkte Demokratie aus. So wie übrigens auch Kurz – allerdings scheint ihn seit einiger Zeit das Thema kaum mehr zu interessieren.
PPS: Was manche Medien als Problem der ÖVP-Vorzugsstimmenregelung herausgearbeitet haben, ist hingegen kein echtes: Das ist mangels einer gesetzlichen Verankerung dieser Regelung die Möglichkeit, dass ein Kandidat auf einem vorderen Listenplatz nicht wie vor der Wahl verabredet auf die Annahme des Mandats verzichtet, wenn jemand anderer ausreichend Vorzugsstimmen gesammelt haben sollte. Es ist jedoch extrem unwahrscheinlich, dass jemand schon unmittelbar nach der Wahl gleich wieder dauerhaft mit jener Partei bricht, die ihn gerade aufgestellt hat. Für die er bei Ausscheiden eines anderen auch der erste wäre, der nachrücken könnte. Und die ihn beim nächsten Mal wieder auf eine Liste setzen könnte. Das setzt keiner aufs Spiel für das frustrierende und perspektivenlose Leben eines wilden Abgeordneten.
Der Autor war 14 Jahre Chefredakteur von „Presse“ bzw. „Wiener Zeitung“. Er schreibt unter www.andreas-unterberger.at sein „nicht ganz unpolitisches Tagebuch“, das heute Österreichs meistgelesener Internet-Blog ist.