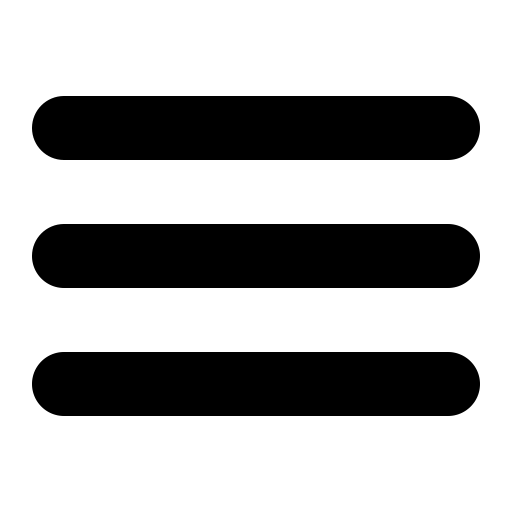Mit den modernen Technologien der Neurowissenschaften haben die Forscher ein Mittel zur Hand, einer besonders beliebten Frage nachzugehen: Wie wirkt Musik auf den Menschen? Dies versucht Lutz Jäncke von der Universität Zürich (UZH) anhand der anatomischen Veränderungen des Gehirns von Musikern abzulesen. Die Begabung als Weg zum Erfolg hält er für maßlos überschätzt, inwiefern die Vererbung ihre Finger im Spiel hat, “wissen wir einfach nicht”, sagt er im APA-Gespräch. Doch “nicht das Gen treibt zum Klavier”, sondern viel mehr die Motivation – und der Rest sei einfach eine Frage des Übens. Der Neuropsychologe hält am Samstag den Eröffnungsvortrag des Themenschwerpunkts “Musik & Gehirn” (1. bis 5. November) im Rahmen des Festivals “Wien Modern”.
Vor allem das Trainingspensum bestimmt laut dem aus Deutschland stammenden Neurowissenschafter die Fähigkeiten eines Musikers. “Das Musizieren braucht Gehirnleistung. Man benötigt die Fähigkeit zum rekursiven Denken”, um etwa schnell Zusammenhänge erfassen zu können, meinte Jäncke. Die hohe kognitive Fähigkeit, die dabei gefordert ist, ist erlern- bzw. ausbaubar. Auch wenn man natürlich nicht jeden gleich “zu einem Lang Lang” am Klavier machen kann, so der Wissenschafter einschränkend.
Dass die Areale eines Gehirns je nach Nutzung und Beanspruchung formbar sind, ist laut dem Wissenschafter seit Anfang der 1990er Jahre anerkannt. Über die damals offen thematisierte “Plastizität” als Forschungsgegenstand sei er, selbst kein Musiker, zu der Musik gekommen: Mit den Profimusikern habe er Probanden für sich entdeckt, bei denen das Gehirn in ein bestimmtes Extrem ausgeprägt sein musste, so Jäncke. Seine Untersuchungen ergaben, dass “jedes Gehirnareal, das beim Musizieren eingebunden ist, sich anatomisch und auch funktionell verändert hat”. Musikergehirne unterscheiden sich von Nichtmusikergehirnen, doch auch unter den Tonkünstlern gibt es Unterschiede: “Der Hörcortex eines Geigers ist anders ausgeprägt als jener des Trompeters. Wir sprechen hier von der Spezialisierung der Spezialisten”, so Jäncke.
Zu jüngeren Untersuchungen des Neuropsychologen, der als Professor am Psychologischen Institut der UZH tätig ist, zählt eine Untersuchung von “Absoluthörern”, also Personen, die einen Ton nur durchs Hören benennen können. Auch hier griff die “Trainings-Hypothese”. Die Fähigkeit der Absoluthörer korrelierte mit der Anzahl der Übungsstunden. Zudem zeigten sich laut Jäncke bei den musizierenden Absoluthörern auch anatomische Unterschiede im linksseitigen, der Sprache zugeordneten Hirnbereich, u.a. bei der Organisation des Sprachcortex.
“Außergewöhnliche Musikfähigkeiten wirkten sich demnach auch auf die Sprache aus”, so Jäncke: “Menschen mit Musikerfahrung zeigen auch Veränderungen am Hörcortex, sie können Sprachlaute besser wahrnehmen und etwa auch besser Fremdsprachen lernen.” Neben diesem “Transfereffekt” gibt es noch einige weitere, die für Jäncke wissenschaftlich bewiesen sind.
So wirke sich Musikfähigkeit auch auf das verbale Gedächtnis aus, wobei dieser Zusammenhang leicht nachvollziehbar ist. Will man sich einzelne Wörter wie etwa einen Namen merken, sagt man ihn sich gemeinhin leise vor – “sie werden akustisch codiert und so leichter abgespeichert”. Will der Musiker Melodien abspeichern, merkt er sie sich am Klang. So kommt es laut Jäncke auch dazu, dass Musiker in verbalen Gedächtnisaufgaben besser abschneiden. Zudem habe sich bei den Tonkünstlern im frontalen Cortex ein geringerer Abbau der grauen Substanz im zunehmenden Alter gezeigt, “da Musiker stärker memorieren”. Als einen weiteren Transfereffekt nannte der Wissenschafter die bessere räumliche Wahrnehmung: Über das Notenlernen trainiere man das “räumliche Analysesystem”.
Vor 20 Jahren habe man noch gelaubt, das Musik und Sprache im Gehirn getrennte Areale besetzten – “dass links die Sprache sei, rechts die Musik. Doch heute weiß man, dass es viele überlappende Bereiche gibt. Das solle man nutzen”, so Jäncke, der hier vor allem auch den medizinischen und therapeutischen Bereich anspricht. Doch nur die Effekte von jenem, “was man in der Kognitionspsychologie erklären kann, sind nutzbar. Auf das sollte man es auch beschränken”, mahnt der Forscher im Hinblick auf viele Mythen oder oberflächliche Ableitungen, welchen Nutzen die Musik für den Menschen hat.
Keinen wissenschaftlichen Beleg gebe es etwa für den häufig zitierten “Mozart-Effekt”, der für Jäncke seit rund drei Jahren als widerlegt gilt. Hier spiele die Emotion mit. “Ich kann Musik sehr unterschiedlich hören, etwa motorisch, sentimental oder assoziativ.” Das sei immer mit unterschiedlicher Hirnaktivität verbunden. Und auch auf den Buchtitel seines jüngst erschienen populärwissenschaftlichen Werks hat Jäncke eine klare Antwort: “Macht Musik schlau?” sei mit “Nein” zu beantworten.