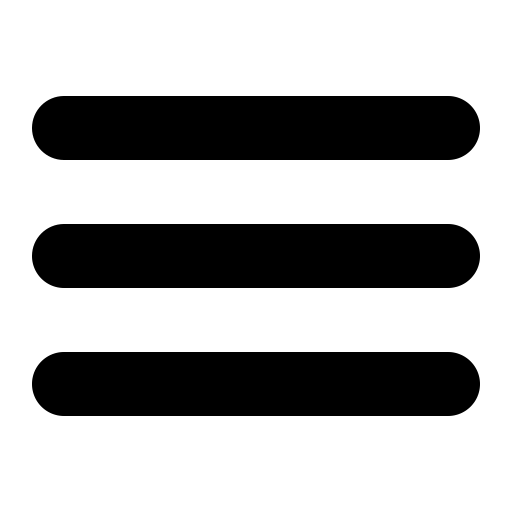Hanno Loewy: In der Mitte einer lebendigen Stadt, in der viele Menschen aus nah und fern entspannt über unsere Gegenwart und Zukunft miteinander streiten. Dieses Ensemble der jüdischen Geschichte ist in den letzten Jahren wachgeküsst worden, weil sich Menschen begeistern lassen hier im Ort.
Hanno Loewy: Hohenems hatte den Ruf, dass sich hier alle verkrachen. Nach meiner Erfahrung hat sich das in den letzten sieben Jahren sehr verändert. Dass die Atmosphäre offener geworden ist, sieht man an den Häusern und auch am Schlossplatz, wo sich diese Stadt wieder einen Mittelpunkt leistet. Was jetzt noch fehlt, ist, dass der Verkehr aus der Stadt rauskommt. Die Vision, die wir haben, ist, dass Hohenems ein einzigartiger Ort der Begegnung wird. Dafür tun wir auch als Museum viel.
Hanno Loewy: Das war sehr früh. Das Museum ist nach seiner Eröffnung ziemlich schnell auf der internationalen Landkarte gewesen. Was daran lag, dass es bereits im Eröffnungsjahr 1991 sensationell reflektiert daherkam. Die Debatten, die geführt worden sind, waren Debatten auf höchstem Niveau. Und ich sage ganz bewusst, dass dieses höher war als in so mancher Großstadt.
Hanno Loewy: Ja, im Vergleich dazu war das, was im Jüdischen Museum in Frankfurt gemacht wurde, brav und bieder was das Konzept betrifft. Hohenems war von Anfang an sicher das kommunikativste Museum. Kommunikativ insofern, als es am meisten auf die unterschiedlichsten Menschen zugegangen ist.
Hanno Loewy: Zum Beispiel, dass es ein Museum war, das von Beginn an Vermittlungsarbeit für Lehrlinge gemacht hat. Es war das erste Jüdische Museum weit und breit, das eine hauptamtliche Vermittlungsarbeit im Programm hatte. Es hat eine Diskussionskultur hinbekommen. Es war auch das erste Museum weit und breit, das sich Fragen der Migration in der Gegenwart geöffnet und sich auch um den Islam gekümmert hat. Mein erster Besuch erfolgte bereits im Jahr 1993. Das Museum hatte angefangen, mit Kollegen zu kooperieren.
Hanno Loewy: Ich kam in einer glücklichen Situation her. Das hatte damit zu tun, dass man Krisen schon ausgestanden hatte. Als Eva Grabherr als Leiterin aufgehört hatte, gab es schwierige Zeiten. Man hatte nicht den Mut, die Richtung, die sie eingeschlagen hatte, weiter zu gehen. Dann gab es eine nicht professionell konstruierte Trägerschaft. Es war nicht ganz klar, ob der Verein oder die Stadt Hohenems das Sagen hat. Mein großes Glück ist, dass die Krise gut ausging, weil es genug Menschen im Land gab, die nicht wollten, dass das Haus vor die Hunde geht. Dann gab es eine Zeit, in der Johannes Inama dafür gesorgt hat, dass Stabilität in den Betrieb kommt. Ich hatte eine traumhafte Ausgangslage, nämlich die Chance, wirklich Neues zu gestalten.
Hanno Loewy: Die Förderung des Landes war kleiner als die der Stadt. Und der Bund hat es nur auf sehr niedrigem Niveau mitgefördert. Wir haben es geschafft, zu einer ausgeglichenen Finanzierungsvereinbarung zu kommen, den Bund viel stärker ins Boot zu holen und viel mehr Sponsoren zu motivieren. Der Eigenanteil liegt nun bei 30 Prozent.
Hanno Loewy: Es gab eine erbitterte Diskussion darüber, welche Objekte gezeigt werden. Schon die erste Ausstellung enthielt eine massive Diskussion über Nationalsozialismus, allerdings in einer musealen Form. Die vielen kopierten Zettel, die erzählten, wie antisemitisch das Volksblatt war, blieben in der Besucherwirkung hinter den Möbeln. Das Haus hatte keine Sammlung. Es war auf spröde Dokumente angewiesen, die wenig darüber verraten haben, was Juden in Hohenems dachten, wie sie selber sich und ihr Leben sahen. Das hat sich geändert, weil Hohenems Anlaufpunkt für Unzählige von Nachfahren der einstigen jüdischen Bewohner geworden ist. Daraus ergab sich, dass wir Dokumente, Tagebücher und Briefe haben, die erzählen, wie Menschen ihre Situation in Hohenems erlebt haben.
Hanno Loewy: Dass es eine Gemeinde von Weltbürgern war. Die Kinder durften ihre Familien nicht in Hohenems gründen, sie mussten hinaus in die Welt gehen. Ihr Leben bestand somit auch aus Kommunikation über große geografische Räume hinweg.
Hanno Loewy: Ja, eine bestimmte wirtschaftliche Blüte. Hohenems wurde früh eine Einwanderungsstadt, was dazu führte, dass sie anders aussieht, weil es diese Mischung aus Villen und einer dörflichen Struktur gab, und dazu kam noch die Nähe zu dieser Adelsfamilie. Da kann man viel europäische Geschichte auf allerengstem Raum erleben. Es gab aber auch eine ambivalente Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden und auch ein hohes Maß an Ebenbürtigkeit. Hohenems war der einzige Ort in Europa, in dem die beiden Hauptstraßen Juden- und Christenstraße hießen.
Hanno Loewy: Es war einzweideutiges Verhältnis. Im Jüdischen Viertel standen die schöneren Häuser, manche Familien wurden ein bisschen bewundert, sie wurden aber gleichzeitig eindeutig diskriminiert. In der bürgerlichen Gesellschaft gab es aber auch ein Zusammenleben. Man war in Vereinen aktiv und schloss Freundschaften. Die jüdische Familie Landauer hatte eine der wichtigsten Kneipen, es gab Heiraten zwischen Juden und Nichtjuden in einer Vorarlberger Gesellschaft, die zur gleichen Zeit extrem antisemitisch geworden war.
Hanno Loewy: Wir haben ein sehr konkretes Thema. Das Aufzeigen des Verhältnisses des Landes zu seiner jüdischen Minderheit weckt bei unseren Besuchern Gedanken über dieeigeneGegenwart, die massiv davon geprägt ist, dass wir Migration haben und in der wir vor dem Problem stehen, wie Menschen verschiedener Religionen miteinander umgehen. Die grundsätzliche Frage ist und die haben sich alle Kultureinrichtungen zu stellen wie wir einen Teil der Gesellschaft, der am Kulturleben nicht teilnimmt, dazu bringen, dass er teil- nimmt.
Hanno Loewy: Sie ist eine gute Möglichkeit, um Kommunikation herzustellen. Eine der nächsten Aufgaben? hanno Loewy: Wir müssen verhindern, dass uns der Erfolg auffrisst, wir haben das Publikum verdreifacht, wir haben eine Sommeruni hier, wir haben eine Presse-Aufmerksamkeit, die einem deutlich größeren Museum entspricht und die für Hohenems auch ein Kapital ist. Wir müssen die Strukturen vergrößern, und das geht nur, wenn sich mehr Menschen daran beteiligen. Kultursponsoring ist leider nicht das, was in Vorarlberg die größte Tradition hat.
Das Interview führte Christa Dietrich-Rudas (VN)