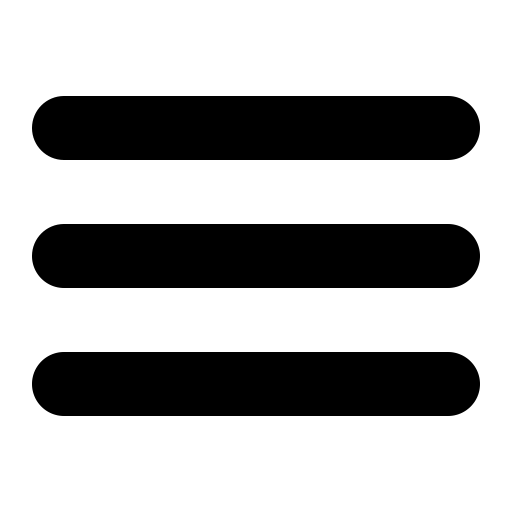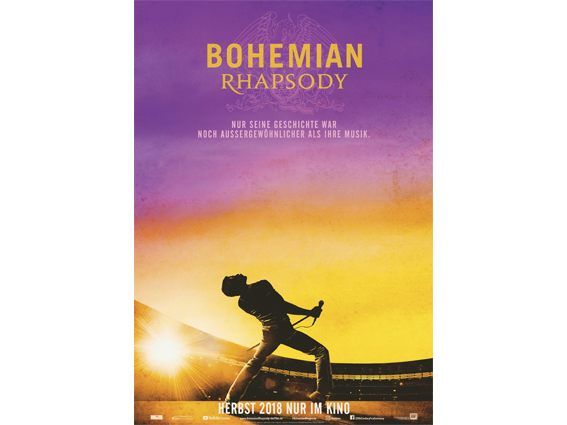Man darf sich wundern, dass nicht schon längst eine Filmbiografie über die britische Rockband Queen existiert – schillernder und reichhaltiger kann kaum ein Plot in diesem Genre sein. Am 31. Oktober steht nun endlich die Verfilmung mit dem Titel “Bohemian Rhapsody” am Start. Von der ersten Idee bis zur Filmpremiere war es allerdings ein wahrlich langer Weg.
Bohemian Rhapsody: Kurzinhalt zum Film
Für Fans gilt aber wohl ohnehin: Hauptsache, dieser Film wurde überhaupt fertiggestellt. Jahrelang wurde gerungen um die Produktion, bei der nicht nur “Borat”-Darsteller Sacha Baron Cohen zwischenzeitlich als Mercury im Gespräch war, sondern auch das Drehbuch mehrfach überarbeitet wurde, es zu den obligaten “kreativen Differenzen” kam und schlussendlich Dexter Fletcher den von Bryan Singer inszenierten Film über die Ziellinie bringen musste (nebenbei: als Regisseur wird aufgrund der bestehenden Regelung nur Singer genannt).
Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um das ohnehin schwierige Genre des Musikfilms zu bedienen. Nun kommt aber das große Plus von “Bohemian Rhapsody”: Hauptdarsteller Rami Malek verleiht seiner Freddie-Mercury-Interpretation viel Glanz und Energie, versteht es, die überzogenen Gesten ebenso zu bedienen, wie er in ruhigeren Momente eine nachdenkliche, äußerst melancholische und verletzliche Seite an den Tag legen kann. Da die Geschichte (Anthony McCarten hat das Buch schlussendlich vollendet) zudem Mercury vollkommen in den Fokus rückt, gibt es reichlich Gelegenheit, sich an Malek sattzusehen.
Von seinem Job in der Gepäckabfertigung am Flughafen Heathrow ist es für den ambitionierten Sohn parsischer Eltern, jedenfalls in dieser Version, kein weiter Weg, bis er sich nach einem Gig an seine künftigen Bandmitglieder Brian May (Gwilym Lee gibt einen herrlichen Wuschelkopf ab) und Roger Taylor (Ben Hardy) herantraut, die soeben ihren Sänger verloren haben. Bereits wenig später steht man, komplettiert mit Bassist John Deacon (Joseph Mazzello), erstmals gemeinsam auf der Bühne, und trotz einiger ungelenker Behandlungen des Mikrofons kündigt sich Großes an.
Bohemian Rhapsody: Die Kritik
So gelungen sich viele musikalische Einsätze durch den Film schlängeln, so lieblos und gehetzt wirkt in dieser Phase die Entwicklung der Handlung: Schlag auf Schlag geht es, von einem Auftritt zum nächsten, vom Verkauf des Vans zur Finanzierung des ersten Albums, bis dann auch schon der lukrative Plattenvertrag in Händen gehalten wird. Auf diesem Weg darf auch Mike Myers als EMI-Manager Ray Foster einen kurzen, aber denkwürdigen, weil äußerst lächerlichen Auftritt abliefern. Da verfolgt man lieber die aufkeimende Beziehung zwischen Mercury und Mary Austin, der Lucy Boynton viel Herz verleiht. Seine Lebensliebe sollte ihn trotz Trennung bis zum Ende begleiten.
Und dennoch: Das persönliche Leben von Freddie Mercury, dem sich “Bohemian Rhapsody” immer wieder zu nähern versucht, bleibt letztlich ein klischeebeladenes Abziehbild. Zwar tut Malek sein Bestes, um hinter die Fassade des extravaganten Musikers und genialen Songwriters blicken zu lassen, aber leider bleibt dafür ganz einfach kaum Zeit. Das Verhältnis zu seinen Eltern? Wird vor dem finalen “Live Aid”-Konzert als emotionaler Quickie eingeschoben. Das exzessive Leben zwischen Drogenkonsum, wechselnden Partnern und bejubelten Konzerten? Schwirrt in rascher Abfolge und mittels altbekannter Stereotype am Publikum vorbei.
Auch Paul Prenter, der als Mercurys persönlicher Manager gänzlich die Rolle des Buhmanns zugeschoben bekommt, wird nur holzschnittartig angelegt – wobei Allen Leech sein Möglichstes versucht, um mit vielsagenden Blicken und falscher Freundlichkeit die Vorgabe zu erfüllen. Stattdessen wird Mercurys Eingeständnis seiner Homosexualität quasi gleichgesetzt mit dem zwischenzeitlichen Auseinanderbrechen der Band, als er sich an einer Solokarriere versuchte. Zu diesem Zeitpunkt war der Rest der Band – erraten – im “normalen” Leben angekommen und hatte Familien gegründet. Ein sehr moralisierender Touch, der, gewollt oder ungewollt, definitiv zu dick aufgetragen ist.
Eingefleischten Fans wird ohnedies sauer aufstoßen, dass etliche biografische Daten, wenn schon nicht verfälscht, so doch aus dramaturgischen Gründen zurechtgeschoben wurden. Mercurys Aids-Diagnose wird zum integralen Bestandteil einer Geschichte, die 1985 endet, obwohl sie mutmaßlich erst zwei Jahre später erfolgt ist. Dass der charismatische Sänger zudem am Tag des “Live Aid”-Auftritts wie im Vorbeigehen einen Gutteil seiner persönlichen Probleme lösen konnte, glauben wohl nicht mal Queen-Novizen.
Also sollte man sich daran festhalten, was bei diesem Film, der eben keine ins Details gehende Dokumentation sein kann und will, gelungen ist: Und das ist neben Maleks Performance definitiv die musikalische Seite dieses Biopics. Wenn man dem Quartett bei den Aufnahmen im Studio zusieht und etwa das Bild eines in frühen Morgenstunden krähenden Hahns mit einem ins Falsett kippenden Taylor geschnitten wird, ist das einfach gelungen und amüsant. Ohnehin sind die Live-Szenen durch die Bank gelungen und authentisch umgesetzt, weshalb nicht wenige Kinosäle wohl von einem herzhaften Mitsingen erfüllt werden dürften. “Bohemian Rhapsody” merkt man die turbulente Entstehung zwar an; aber die Songs von Queen sind auch in dieser Inkarnation ein ums andere Mal hörenswert.
(APA/Red)