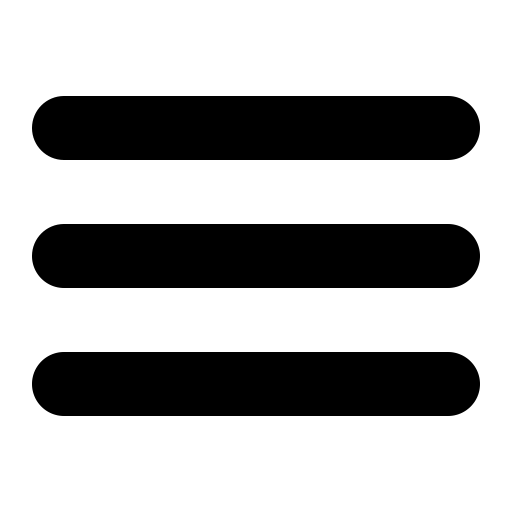Corona-Todesfälle: Mehr als fünf Millionen Kinder verloren nahe Angehörige

Damit übersteigt ihre Zahl die in dem 20-monatigen Untersuchungszeitraum (März 2020 bis Oktober 2021) verzeichneten fünf Millionen Corona-Todesfälle, wie internationale Forscher herausfanden und am Donnerstag im Fachmagazin "Lancet Child Adolescent Health" bekannt gaben.
Pro Corona-Todesfall mehr als ein betroffener Minderjähriger
Das bedeutet, dass auf jeden Corona-Todesfall mehr als ein Minderjähriger oder eine Minderjährige kommt, der oder die einen Elternteil oder Sorgeberechtigten verloren hat. Für ihre Auswertung bezogen sich die unter anderem am Londoner Imperial College tätigen Wissenschafter auf verfügbare offizielle Daten zu den in den jeweiligen Nationen verzeichneten Corona-Todesfällen sowie zur Übersterblichkeit und stellten auf dieser Basis Modellierungen an. Die genannten Zahlen könnten den Forschern verschiedener Universitäten zufolge auch noch rückwirkend ansteigen, wenn sich die Datenqualität verbessert. Denn in vielen Regionen wird mit einer extrem hohen Dunkelziffer gerechnet.
Zwei von drei Minderjährigen, die in der Pandemie einen Elternteil oder eine sorgeberechtigte Person verloren haben, waren demnach im Alter von zehn bis 17 Jahren. Außerdem wird aus den Daten sehr deutlich, dass Männer häufiger an Covid-19 gestorben sind als Frauen: Drei von vier betroffenen Kindern und Jugendlichen haben ihren Vater verloren.
Corona-Todesfälle: Enorme regionale Unterschiede
Außerdem zeigten sich enorme regionale Unterschiede: Während in Indien in dem Zeitraum rund 1,9 Millionen Kinder einen Verlust erlitten und in Mexiko 192.000, waren es etwa in Deutschland lediglich 2.400. Davon verloren 1.800 ihren Vater, 600 die Mutter.
Die Forscher sprechen sich auf Basis ihrer Auswertung dafür aus, die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die Eltern oder enge Bezugspersonen verloren haben, stärker politisch zu berücksichtigen. So müssten entsprechende Programme geschaffen werden, die auf ihre speziellen Erfahrungen eingehen. Insbesondere bei Jugendlichen bestehe ansonsten ein erhöhtes Risiko für psychische und körperliche Erkrankung, negative Auswirkungen auf die Bildung oder ihre Bindung zur Familie.
(APA/Red)