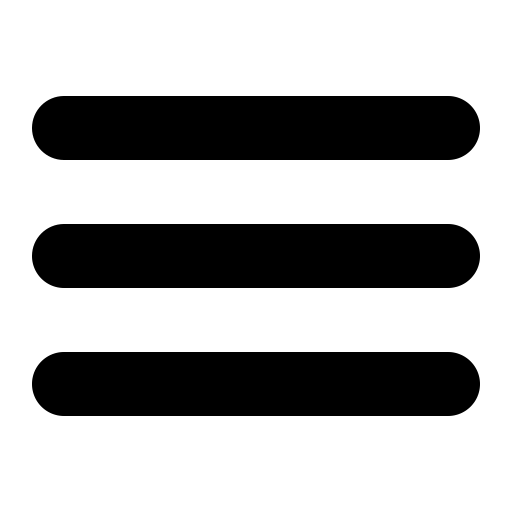Wiener Staatsoperndirektor Meyer geht in seine letzte Saison
Dominique Meyer blickt auf ein erfolgreiches Jahr als Direktor der Wiener Staatsoper zurück, wo man mit den Zahlen der laufenden Saison über Plan liegt und mit Johannes Maria Stauds “Die Weiden” am 8. Dezember die erste Uraufführung seit acht Jahren absolvierte. Mit 2019 stehen nun zugleich die Jubiläumsfeierlichkeiten am Haus wie der Beginn von Meyers Abschiedssaison an.
Zum Jahreswechsel sprach der 63-Jährige Opernchef mit der APA darüber, dass er seine Amtszeit vielleicht zu pädagogisch durchdacht hatte, weitere Karrierepläne und über die Frage, weshalb er allen Uraufführungen ein Fiasko wie dem “Barbier von Sevilla” wünscht.
APA: Sie haben zum Jahresende mit “Die Weiden” Ihre erste Uraufführung im Haupthaus vorgelegt. War das für Sie als Direktor auch eine andere Erfahrung?
Dominique Meyer: Eine Uraufführung ist für einen Direktor einfach interessant: Das Stück kommt erst wirklich zum Leben bei der Orchesterprobe und man nimmt gemeinsam mit Komponist und Regisseur bis zum Ende Änderungen vor. Wenn man ein Repertoirestück spielt, kennt man ja das Stück und hat bereits eine Vorstellung. Hier nicht. Und die Hierarchie in der Vorbereitung ist eine andere. Normalerweise sind die Regisseure die Könige, während die Komponisten kein Mitspracherecht haben, weil sie tot sind. Das war in diesem Falle anders.
Schwierigkeiten mit zeitgenössischer Musik
APA: Woher rühren die Schwierigkeiten, die viele Zuschauer dennoch mit der zeitgenössischen Musik haben?
Meyer: Die Musik ist so komplex, dass man die Struktur erst wirklich durchschaut, wenn man das Stück mehrmals gesehen hat. Das ist das Defizit bei jeder Uraufführung, weil Zuschauer das natürlich meist nicht können. Ich erinnere mich aber noch daran, als ich das erste Mal die “Eroica” gehört habe – und das Werk praktisch überhaupt nicht verstand. Auch wenn man ein Bild von Nicolas Poussin für 15 Sekunden sähe, könnte man nichts erfassen.
APA: “Die Weiden” sind ein gesellschaftspolitischer, beinahe tagesaktueller Kommentar. Minimiert das die Chancen, ein Repertoirewerk zu werden?
Meyer: Das sehe ich anders. Sonst würde man zwei Drittel der Verdi-Opern in den Mistkübel werfen. Ich glaube, dass die Themen der “Weiden” auch in 20 oder 30 Jahren noch aktuell sind. Ob es ein Repertoirestück wird, kann man aber schwer prognostizieren.
APA: Ist diese Frage für Sie überhaupt von Relevanz?
Meyer: Besser wäre es natürlich, nach all der Arbeit, die in so ein Werk fließt. Man darf nicht vergessen, dass die Bezeichnung “Fiasko” mit dem Misserfolg der Uraufführung des “Barbier von Sevilla” geprägt wurde. Heute gehört es zu den meistgespielten Werken. Solch ein “Fiasko” kann man also jedem neuen Stück wünschen.
APA: Angesichts der Aufnahme der “Weiden”: Ärgern Sie sich nun, nicht früher eine Uraufführung in ihrer Amtszeit angesetzt zu haben?
Meyer: Man kann nicht auf Knopfdruck Uraufführungen vorlegen. Ich habe ja vier Auftragswerke initiiert, und letztlich werden davon zwei gespielt werden. Es dauert einfach – und wenn Sie ein Notenblatt der “Weiden” sehen, wissen Sie warum. Aber ich bereue nichts. Mein Traum wäre gewesen, in jeder Spielzeit eine Uraufführung zu haben. Aber zwischen Traum und Realität klafft manchmal eine Lücke. Sicher hängt einem dann ein Image an, aber so einfach funktioniert das Leben nicht. Ich bin der Erste, der enttäuscht ist, wenn es ein Projekt nicht auf die Bühne schafft. Aber das muss man akzeptieren. Ich bin ein Praktiker. Mein Zugang war, dass ich zunächst wichtige Stücke des frühen 20. Jahrhunderts wie “Mahagonny”, “Cardillac” oder Janacek erstmals am Haus zeigen und darauf dann aufbauen wollte. Aber das war zu pädagogisch gedacht. Das war vielleicht ein Fehler.
APA: Ein weiteres Vorhaben war die Stärkung des Ensembles. Ist das in Ihren Augen gelungen?
Meyer: Da bin ich vollends glücklich. Vielleicht habe ich auch da anfangs falsche Erwartungen geweckt, denn auch ein Ensembleaufbau braucht Zeit. Ich höre mir im Jahr 900 Sänger an – und davon hole ich vielleicht zwei ans Haus! Aber dass wir “Dantons Tod”, “Les Troyens” oder “Die Weiden” primär aus dem Ensemble besetzen können, ist ein Zeichen für die Stärke des Hauses, die von Chen Reiss über Aida Garifullina bis Olga Bezsmertna reicht.
APA: Massiv ausgebaut wurde in den vergangenen Jahren zudem die Übertragung von Aufführungen der Staatsoper. Verändern sich durch Stilmittel wie Nahaufnahmen auch die Inszenierungen?
Meyer: Wir wollen die Übertragung so neutral wie möglich halten, damit der Zuschauer am Bildschirm einen ähnlichen Eindruck wie derjenige im Haus hat. Aber es gibt eine Änderung, die mir sehr recht ist: Man sieht alles! Deshalb muss man bei Kostüm, Maske und Bühnenbild viel vorsichtiger sein. Dadurch ist die ganze Mannschaft aufmerksamer (lacht). Ein weiterer Vorteil ist, dass die Inszenierungen besser dokumentiert sind, was uns bei Wiederaufnahmen hilft.
APA: Blicken wir in die Zukunft: 2019/2020 wird Ihre letzte Spielzeit an der Staatsoper. Wie wollen Sie diese letzte Saison anlegen?
Meyer: Ich will es genießen. Und ich möchte, dass es die Zuschauer genießen. Ich will es einfach gut machen und das Haus in gutem Zustand an Bogdan Roscic übergeben. Die Renovierung ist abgeschlossen, und die Finanzen sind gut.
Was bleibt von der Ära Meyer?
APA: Was soll bleiben von der “Ära Meyer”?
Meyer: Die meisten Namen von Staatsopern-Direktoren hat man vergessen – und das wird auch bei mir geschehen. Aber ich habe mich vom Publikum sehr gut angenommen gefühlt. Toscanini hat einmal gesagt: Man muss zuerst an die Kasse gehen, um zu sehen, ob ein Opernhaus funktioniert. Und unsere Kasse ist voll! Wir haben seit Anfang der aktuellen Spielzeit wieder alle Rekorde gebrochen. Und wenn es bei einer Uraufführung wie den “Weiden” 15 Minuten Applaus gibt und an vielen großen Häusern bei einer “Boheme” nicht mehr als zwei Minuten, dann ist das der Beweis, dass das Wiener Publikum etwas Besonderes ist. Die Staatsoper ist natürlich ein internationales Haus – aber im besten Sinne auch ein Bezirkstheater für die Wiener. Für mich ist wichtig, dass das nicht kaputt gemacht wird und wir diese Leidenschaft für die Oper auch an die nächste Generation weitergeben.
APA: Mit etwas Abstand zur Entscheidung: Überwiegt bei Ihnen noch die Enttäuschung, dass Sie nicht an der Staatsopernspitze bleiben dürfen, oder fokussieren Sie sich schon auf den Aufbruch zu neuen Ufern?
Meyer: Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich wäre gerne hier geblieben. Aber manchmal entscheidet man nicht selbst im Leben. Ich bin aber nicht verbittert. Einzig das Benehmen einiger Proponenten hat mich enttäuscht, aber auch das werde ich vergessen. Was bleiben wird, ist die Freude, die ich hier empfunden habe. Es gibt ja nicht viele Menschen auf der Welt, die diese Arbeit machen durften! Natürlich gibt es Intrigen, das darf man nicht leugnen. Aber wenn ich mir anschaue, was einige meiner Vorgänger erlebt haben, war das moderat (lacht). Man kann nicht von allen geliebt werden. Aber in den zwölf Jahren seit meiner Bestellung wurde ich nur zweimal im negativen Sinne als “Franzose” angegriffen – das ist nicht viel. Ich weiß, dass ich vom Leben verwöhnt wurde.
APA: Wohin zieht es Sie nach Ihrer Zeit an der Staatsoper?
Meyer: Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich kenne mich: Ich werde nichts machen, wo ich nicht auf hohem Niveau arbeiten kann.
APA: Das limitiert die Auswahl natürlich…
Meyer: Das ist mir bewusst. (lacht) Schauen wir, ob mir das Schicksal noch ein Geschenk macht.
APA: Wäre die neuerliche Führung eines Opernhauses für Sie vorstellbar?
Meyer: Ich mache das gerne. Aber es muss nicht unbedingt eine Oper sein. Ich möchte mit Musik zu tun haben. Wenn ich das Haus verlasse, werde ich über 3.000 Opernaufführungen unter meiner Ägide gehabt haben. Das ist ein Erfahrungsschatz.
Salzburger Osterfestspiele zu wenig
APA: Die Leitung der Salzburger Osterfestspiele hätte Sie nicht interessiert?
Meyer: Es hätte mich interessiert, wenn ich das nicht als Hauptberuf machen hätte müssen. Eine Oper mit zwei Aufführungen und ein paar Konzerte ist mir – bei allem Respekt für die Osterfestspiele – einfach zu wenig. Ich mag den alltäglichen Trubel einer Institution.
APA: Wäre eine Rückkehr zu Ihren Wurzeln in der französischen Politik keine Option?
Meyer: Das habe ich 1993 hinter mir gelassen – nachdem ich eine sehr gute Phase des Staates mitgestalten durfte. Mir hat es sehr gefallen mit Ministern wie Jack Lang zusammenzuarbeiten. Und ich habe vieles erlebt, wie etwa den Dienst in der Nacht, in der Michael Gorbatschow abgesetzt wurde, was ich dem Premierminister melden musste. Auch ein Sicherheitsgesetz zum Schutz der Fans nach einer Katastrophe in einem Fußballstadion, das ich machen durfte, gehört dazu. Da weiß niemand, dass es von mir kommt, aber das ist auch ein Vermächtnis. Dinge im Allgemeininteresse zu korrigieren, die nicht funktionieren, habe ich genossen. Aber die politische Welt macht einen sukzessive zu einer anderen Person. Und das wollte ich nicht.
Die Lage in Frankreich
APA: Als nach wie vor politisch denkender Mensch: Wie sehen Sie die politische Lage Frankreichs derzeit?
Meyer: Das ist eine sehr schwer zu steuernde Situation. Ein ernstes Problem ist die Lage der staatlichen Schulden. Auch gibt es immer mehr Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen und die man vergessen hat. Zugleich gibt es bis auf das Rassemblement National (früher Front National, Anm.) keine wirkliche Partei mehr in Frankreich. Das bedeutet, dass die Politik keine Vermittlung mehr in Richtung Volk betreiben kann. Und dann sind auch noch die Gewerkschaften geschwächt. Die Gelbwesten gibt es jetzt, weil die Gewerkschaften nicht mehr existieren und somit eine weitere vermittelnde Instanz wegfällt.
APA: Sind die Gelbwesten eine vorübergehende Erscheinung?
Meyer: Man muss betonen, dass die Zahl der Demonstrierenden sehr gering ist, wenn 13.000 in einer elf Millionen Einwohner zählenden Stadt auf die Straße gehen. Aber die Medien zeigen dasselbe Feuer immer wieder, und man bekommt den Eindruck, ganz Paris brenne. Dennoch muss man angesichts der sozialen Lage konstatieren, dass in Frankreich Europa unter Beschuss gerät. Wenn 80 Prozent der Bevölkerung nie ins Ausland reisen, weil sie die Mittel dafür nicht haben: Welchen Wert messen sie dem Euro bei? Was ist der Wert eines Ausweises, den man an der Grenze nicht zeigen muss, wenn man nie eine Grenze überquert? Ich denke seit langem, dass man etwas gegen die Armut machen muss. Aber Frankreich zu regieren, ist nicht leicht. Es obsiegt nicht immer die Vernunft.
(APA/red)