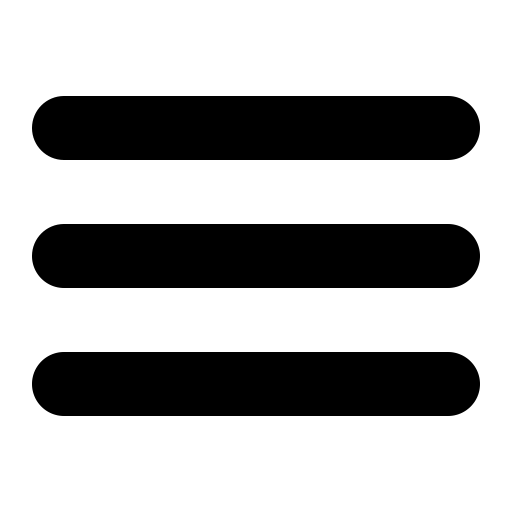Viele Praktiker bemerken, dass die gesundheitliche Versorgung in Haftanstalten im deutschsprachigen Raum prekär ist, bemerkte Heino Stoever, Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen, in einem Round Table-Gespräch mit der APA. Der Suchtproblematik, einer hohen Anzahl an psychischen erkrankten Insassen und den Folgen der erzwungenen Bewegungsarmut sei in vielen Vollzugsanstalten schwer beizukommen.
Sieben bis zehn Prozent der Häftlinge geraten im Gefängnis erstmals in Kontakt mit harten Drogen, zitierte Caren Weilandt vom Wissenschaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD) eine internationale Studie. Die Folge sind Infektionskrankheiten, die in den Haftanstalten in weit stärkerem Maße auftreten als draußen, legte Weiland dar.
Angesichts zum Teil erschreckend hoher HIV- und Hepatitis-Erkrankungen tritt sie daher für dieselben Zugangsmöglichkeiten für Prävention wie außerhalb ein: Der Zugang zu sterilem Spritzbesteck wäre wünschenswert. Weilandt verweist auf ein Modell in spanischen Vollzugsanstalten, wo Spritzentausch anonym und flächendeckend möglich ist.
Wichtig wäre es vor allem, externe Fachleute in die Prävention miteinzubinden, sagte Sylvia Urban, Bundesvorstand der Deutschen AIDS-Hilfe. Dies zu unterlassen, komme einer Benachteiligung der drogenkranken Häftlinge gleich.
Als relativ gut, aber nicht optimal bezeichnete Harald Spirig, Geschäftsführer des Schweizer Haus Hadersdorf (SHH) – eine auf stationäre und ambulante Drogentherapie spezialisierte Einrichtung – die medizinische Betreuung Suchtmittelabhängiger im heimischen Strafvollzug. Die flächendeckende Versorgung mit dem Heroin-Substitutionsmittel Methadon sei in Österreichs Gefängnissen beispielsweise garantiert.
Eine umfassende ganzheitliche Versorgung fehlt allerdings, so dass wir eine Lose-Lose-Situation haben: Keine ausreichende Gesundheitsvorsorge im Gefängnis, nicht zuletzt mangels medizinisch geschulter Betreuer, wodurch auch das Wachpersonal und die Gesellschaft verliert, bedauerte Spirig.
Die mit kranken Häftlingen konfrontierte Justizwache werde oft selbst krank. Und nach der Entlassung der Insassen habe dann die Gesellschaft mit den oft unzureichend bis gar nicht behandelten Patienten umzugehen, stellte Spirig fest.
Im Justizministerium sei grundsätzlich eine Offenheit für dieses Thema dar, meinte der Experte. Dass neue Ansätze im Strafvollzug nicht nur den Gefangenen etwas bringen, lässt sich nämlich an Zahlen ablesen: 1995 wurde in der Justizanstalt Hirtenberg eine so genannte drogenfreie Zone eingerichtet. Wer in diesem Vollzugsbereich einsitzt, verpflichtet sich, kein Haschisch, keine Medikamente und keine harten Drogen zu konsumieren.
Die Einhaltung wird mit regelmäßigen Harntests kontrolliert. Im Gegenzug genießen die Insassen gewisse Freiheiten wie verstärkte sportliche Aktivitäten oder eine großzügigere Auslegung des Besuchsrecht.
Seither ist in Hirtenberg die Ausgabe von Psychopharmaka und der Bedarf an psychologischer Betreuung deutlich zurück gegangen. Und die Krankenstandsrate des Wachpersonals hat sich von durchschnittlich 15 auf vier Prozent reduziert.