Von der Anzeige zur Anklage: So funktioniert das Strafrecht in Österreich
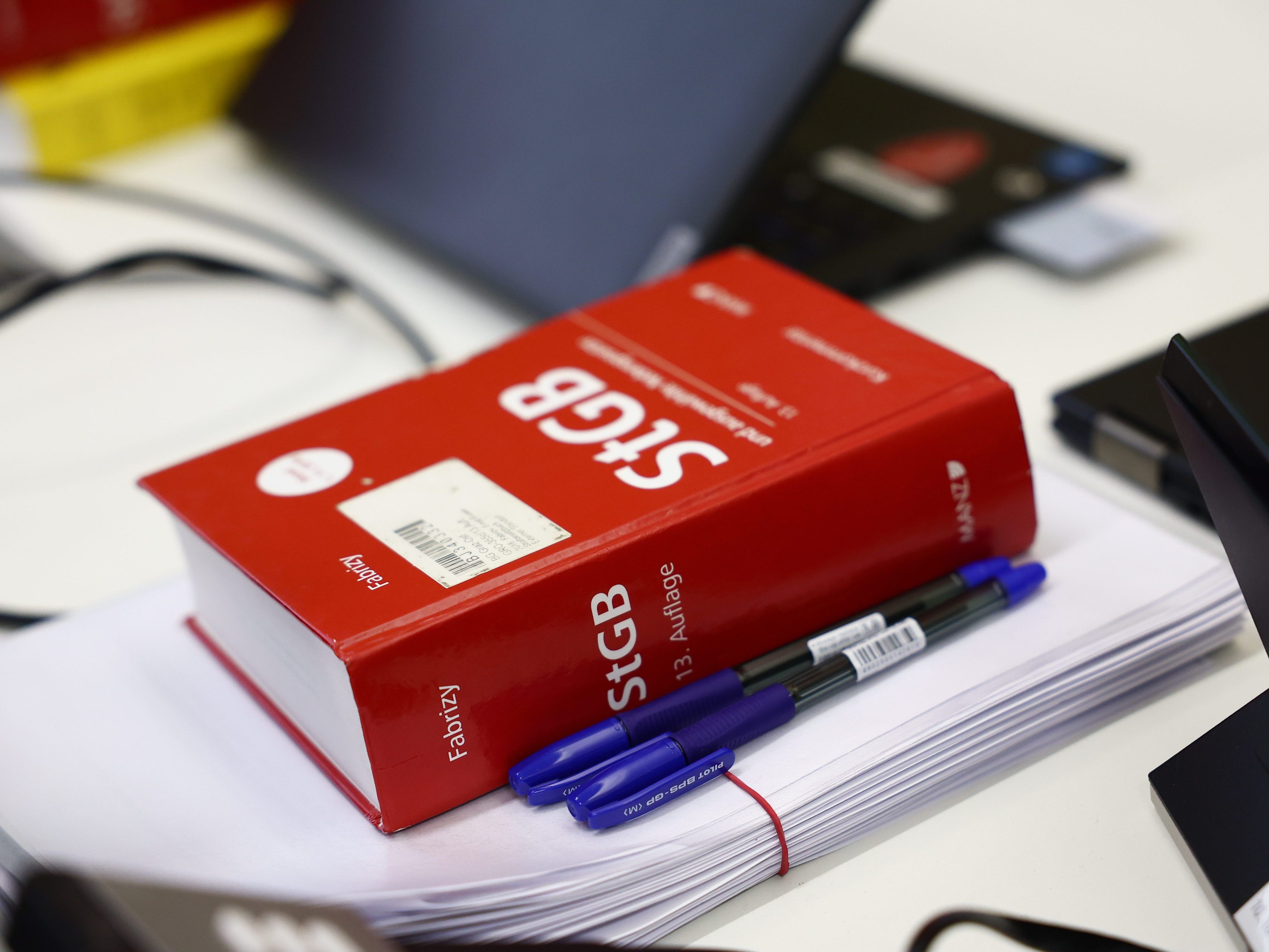
Wenn die Polizei plötzlich vor der Tür steht, eine Vorladung ins Haus flattert oder ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, ist die Verunsicherung oft groß. Was bedeutet es, als Beschuldigter geführt zu werden? Wann kommt es zur Anklage – und wer kann überhaupt belangt werden? Das österreichische Strafrecht kennt klare Abläufe und Regeln, die Betroffene kennen sollten. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ablauf strafrechtlicher Ermittlungen und Gerichtsverfahren im Überblick.
Ablauf der Ermittlungen
Wie werden Ermittlungen eingeleitet?
Die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft sind verpflichtet, jede ihnen zur Kenntnis gebrachte Straftat in einem Ermittlungsverfahren von Amts wegen aufzuklären. Voraussetzung dafür ist ein Anfangsverdacht. Ein solcher liegt vor, wenn aufgrund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist. Das bedeutet, es muss ein hinreichender Anlass - etwa bestimmte Anhaltspunkte - für die Annahme einer Straftat gegeben sein. Das kann auf einer Anzeige oder eigener Wahrnehmung der Kriminalpolizei oder der Staatsanwaltschaft fußen.
Behörden und in bestimmten Fällen auch Ärztinnen und Ärzte sind zur Strafanzeige verpflichtet, wenn sie im Zuge ihrer Tätigkeit von strafbaren Handlungen erfahren - etwa beim Verdacht von Gewalt gegen Frauen oder Missbrauch von Minderjährigen. Privatpersonen sind zur Strafanzeige bei Polizei oder Anklagebehörde berechtigt, aber nicht verpflichtet. Anzeigen, die Offizialdelikte - etwa Mord, Körperverletzung, Raub oder Betrug - betreffen, können nicht zurückgezogen werden, sondern werden von Amts wegen weiterverfolgt.
Ab wann ist man ein Beschuldigter bzw. Beschuldigte?
Sobald eine Person aufgrund bestimmter Tatsachen konkret verdächtigt wird, eine strafbare Handlung begangen zu haben, wird der Begriff des Beschuldigten bzw. der Beschuldigten von Polizei und Staatsanwaltschaft verwendet. Dafür werden zur Aufklärung dieses konkreten Verdachts Beweise aufgenommen oder Ermittlungsmaßnahmen angeordnet oder durchgeführt - etwa Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung von Gegenständen, körperliche Untersuchung, Festnahme oder Verhängung der Untersuchungshaft.
Wann wird Untersuchungshaft verhängt?
U-Haft wird verhängt, wenn ein dringender Tatverdacht besteht und ein Haftgrund vorliegt. Dazu zählen Tatbegehungsgefahr, Verabredungs- bzw. Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr. Den Antrag dafür stellt die Staatsanwaltschaft. Jede festgenommene Person muss binnen 48 Stunden dem Richter oder der Richterin vorgeführt werden, der oder die dann entscheidet, ob der Beschuldigte freigelassen wird oder ob über ihn eine Untersuchungshaft verhängt wird. Die U-Haft muss verhältnismäßig sein und darf nur angeordnet werden, wenn andere, mildere Mittel nicht ausreichen, um den Zweck der Haft zu erreichen. Im Falle der Verhängung einer U-Haft beträgt die Haftfrist 14 Tage ab Verhängung der Untersuchungshaft, einen Monat ab erstmaliger Fortsetzung der Untersuchungshaft und zwei Monate ab weiterer Fortsetzung der Untersuchungshaft. In diesen regelmäßigen Abständen finden die Haftverhandlungen statt.
Sind Menschen von Ermittlungen ausgenommen?
Ja, Kinder, die bei der Tatausführung noch nicht 14 Jahre alt waren, sind grundsätzlich schuldunfähig. Besondere Regelungen gelten auch für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, etwa wenn sie noch nicht reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.
Für strafmündige Personen können rechtswidrige Taten allerdings durch bestimmte Gründe gerechtfertigt sein, etwa wenn sich diese Person in einer Notwehrsituation befindet. Ist eine rechtswidrige Tat nach Ansicht des Gerichts gerechtfertigt, wird der Täter nicht bestraft, sondern freigesprochen.
Eine rechtswidrige Tat wird auch dann nicht bestraft, wenn der Täter nicht schuldfähig ist oder Entschuldigungsgründe vorliegen. Nicht schuldfähig sind beispielsweise - wie vom Gesetz her benannte - Geisteskranke oder Menschen, die zum Tatzeitpunkt an einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung litten und dadurch unfähig waren, das Unrecht ihrer Tat einzusehen. Ein Entschuldigungsgrund, der die Schuld an der rechtswidrigen Tat entfallen lässt, kann beispielsweise auch sein, dass eine Person, um ihr eigenes Leben zu retten, einer anderen Person eine lebensrettende Maßnahme verwehrt.
In Österreich sind aber auch bestimmte Personengruppen durch Immunität oder andere Regelungen von Ermittlungen ausgenommen oder unterliegen besonderen Verfahren. Dazu gehören Abgeordnete zum Nationalrat, die nur mit Zustimmung des Nationalrates verhaftet werden dürfen, und diplomatische Vertreter.
Anklage und Prozess
Wann kommt es zur Anklage?
Die Staatsanwaltschaft verschafft sich in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei im Ermittlungsverfahren ein genaues Bild über die Tat. Leitungsfunktion hat die Anklagebehörde, die über die Fortführung oder auch über die Beendigung des Strafverfahrens entscheidet. Die Staatsanwaltschaft kann der Polizei auch Ermittlungsaufträge erteilen. Die Umsetzung der Anordnungen kann die Kriminalpolizei jedoch aufgrund taktischer Überlegungen selbst festlegen.
Bestimmte grundrechtsrelevante Eingriffe während des Ermittlungsverfahrens - wie etwa Hausdurchsuchungen oder Telefonüberwachung - muss die Anklagebehörde jedoch bei Gericht beantragen. Bewilligt das Gericht die beantragte Maßnahme, muss diese innerhalb einer bestimmten Frist umgesetzt werden. Wenn ein Beschuldigter oder eine Beschuldigte eine Ladung zur Vernehmung erhält, dann ist er bzw. sie dazu verpflichtet, dem auch Folge zu leisten.
In Österreich wird dann Anklage erhoben, wenn die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen zum Schluss kommt, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Das wird als "hinreichender Tatverdacht" bezeichnet.
Wann landen Verhandlungen vor einem Schöffensenat und wann vor einem Geschworenengericht?
Bei kleineren Delikten wie etwa Diebstahl entscheidet ein Einzelrichter bzw. -richterin. Zu Schöffensenaten - bestehend aus einem oder zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen - kommt es bei einer Strafdrohung von über fünf Jahren. Hier entscheiden Berufs- und Laienrichter gemeinsam über Schuld und Strafrahmen. Geschworenengerichte werden bei besonders schweren Verbrechen wie etwa Mord eingesetzt. Zwar leitet ein Berufsrichter die Verhandlung, ist aber gemeinsam mit zwei beisitzenden Berufsrichtern an der Entscheidung über die Schuldfrage nicht beteiligt. Über Schuld und Unschuld entscheiden hier alleine die Geschworenen. Das nennt man Wahrspruch. Dieser muss nicht begründet werden. Allerdings besteht die Möglichkeit, einen Wahrspruch von Geschworenen wegen Irrtums aufzuheben und dem Obersten Gerichtshof (OGH) vorzulegen. Dieser verweist die Sache dann an ein völlig neu zusammengesetztes Geschworenengericht, das den Fall neu verhandelt.
Muss ein Angeklagter vor Gericht eine Aussage machen?
Nein, der oder die Angeklagte kann sich der Aussage entschlagen und muss keine Angaben machen. Er kann vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Ein Beschuldigter muss auch nicht die Wahrheit sagen, allerdings ist ein Geständnis der wesentlichste Milderungsgrund.
Müssen Zeugen die Wahrheit sagen?
Ja, Zeugen müssen die Wahrheit sagen. Sie sind verpflichtet, richtig und vollständig auszusagen. Eine falsche Zeugenaussage ist gerichtlich strafbar. Allerdings hat der Zeuge ebenfalls das Recht zur Aussageverweigerung, wenn er sich selbst oder nahe Angehörige bei wahrheitsgemäßen Angaben strafrechtlich gefährden könnte oder wenn er Berufsgeheimnisträger ist. Das gilt etwa für Verteidiger, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Verfahrensanwälte in Untersuchungsausschüssen des Nationalrats, Notare und Wirtschaftstreuhänder, wenn sie Informationen haben, die sie in ihrer Eigenschaft erhalten haben. Auch darunter fallen Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungshelfer, eingetragene Mediatoren nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz und Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und Betreuung. Auch Journalisten, Medieninhaber sowie Medienmitarbeiter müssen Fragen, welche die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmannes bzw. -frau - sogenannte Informanten - von Beiträgen und Unterlagen betreffen oder die sich auf Mitteilungen beziehen, die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemacht wurden, nicht beantworten. Als Zeuge muss man sich auch nicht selbst belasten.
Gar nicht als Zeugen befragt werden dürfen Geistliche über das, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut wurde, Beamte über Umstände, die der Amtsverschwiegenheit unterliegen, soweit sie nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbunden wurden, und Personen, denen Zugang zu klassifizierten Informationen des Nationalrates oder des Bundesrates gewährt wurde, soweit sie gemäß des Bundesgesetzes über die Informationsordnung des Nationalrates und des Bundesrates zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Aber auch Personen, die wegen einer psychischen Krankheit, wegen einer vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit oder aus einem anderen Grund unfähig sind, die Wahrheit anzugeben, dürfen nicht als Zeugen herangezogen werden.
Arten und Ausmaß von Strafen
Was ist der Unterschied zwischen einer bedingten und einer unbedingten Strafe?
Eine unbedingte Freiheitsstrafe ist grundsätzlich zu verbüßen. Bei einer bedingten Haftstrafe erhält der oder die Verurteilte eine gewisse Probezeit. Die auf Bewährung nachgesehene Gefängnisstrafe ist nur dann zu verbüßen, wenn der oder die Verurteilte während der laufenden Probezeit erneut eine Tat begeht oder eine sonstige Auflage missachtet. Das ist beispielsweise der Fall, wenn er oder sie seine oder ihre Bewährungsauflagen nicht einhält. Eine dieser Auflagen kann etwa Bewährungshilfe, ein Anti-Gewalt-Training oder eine Drogentherapie sein. Es gibt auch die Möglichkeit, teilbedingte Strafen zu verhängen, dann muss nur ein Teil fix im Gefängnis abgesessen werden, danach erfolgt die Enthaftung auf Bewährung.
Wie hoch können Strafen ausfallen?
Die Höhe einer Haftstrafe in einem Strafprozess hängt von der Art des Delikts ab. Eine Freiheitsstrafe kann auf bestimmte Zeit - ein Tag bis 20 Jahre oder lebenslang verhängt werden. Zudem kann sich das Verhalten des Beschuldigten vor und beim Prozess auf das Urteil sowohl mildernd als auch erschwerend auswirken. Milderungsgründe sind etwa ein Geständnis, ein ordentlicher Lebenswandel oder ein Beitrag zur Aufklärung des Sachverhalts.
Im Strafgericht können auch Geldstrafen verhängt werden, jedoch wird dies eher beim Verwaltungsgericht angewandt. Um eine gleichmäßige Belastung der Bestraften bei unterschiedlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen zu ermöglichen, werden die Geldstrafen in Tagessätzen bemessen. Die Anzahl der verhängten Tagessätze legt das Gericht im Rahmen der eigentlichen Strafzumessung fest. Geldstrafen betragen mindestens zwei Tagessätze. Der Tagessatz wird nach den persönlichen Verhältnissen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Verurteilten zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils festgelegt. Ein Tagessatz kann mindestens vier Euro und höchstens 5.000 Euro betragen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Geldstrafe und einer Geldbuße?
Eine Geldstrafe darf nur aufgrund einer gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen Entscheidung verhängt werden. Sie ist der häufigste Fall einer Verwaltungsstrafe. Bußgelder für Verkehrsvergehen werden in der Regel durch Organmandate (Organstrafverfügungen) oder eine Anonymverfügung eingehoben. Besonders schwere Übertretungen können zu einem Strafverfahren führen.
Kann ein Verfahren auch ohne Urteil zu Ende gehen?
Ja, denn es gibt auch die Möglichkeit, bei leichten und mittelschweren Straftaten, bei der der Strafrahmen unter fünf Jahren liegt, ein Verfahren diversionell zu erledigen. Dabei muss der Sachverhalt hinreichend geklärt sein und der oder die Beschuldigte die Verantwortung der ihm bzw. ihr zur Last gelegten Tat übernehmen. Eine Diversion bietet die Möglichkeit, ein Strafverfahren zu beenden, ohne dass ein Strafgericht über die Schuld oder Unschuld des Beschuldigten entscheidet. Das Verfahren endet ohne Urteil, der oder die Beschuldigte bleibt formell unbescholten. Stattdessen unterwirft er oder sie sich freiwillig gewissen für ihn oder sie belastenden Maßnahmen - das kann ein Geldbetrag sein, ein Tatausgleich, gemeinnützige Leistungen oder eine Probezeit. Wird das nicht eingehalten, kann die Staatsanwaltschaft die Fortsetzung des Strafverfahrens beantragen.
Gibt es in Österreich die Todesstrafe?
Nein. Laut Artikel 85 des Bundesverfassungsgesetzes gilt in Österreich die Todesstrafe als abgeschafft.
Was bedeutet es, wenn jemand in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen wird?
Wer zum Tatzeitpunkt wegen einer Geisteskrankheit, einer geistigen Behinderung, einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuldhaft und ist somit zurechnungsunfähig. Diese Menschen werden nicht als Angeklagte, sondern als Betroffene geführt. Wenn jemand in einem die Zurechnungsfähigkeit auszuschließenden Zustand eine Tat begeht, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht ist, kann nach Paragraf 21/1 Strafgesetzbuch zur Behandlung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum auf unbestimmte Zeit eingewiesen werden. Die Betroffenen werden dort so lange angehalten, bis sich eine deutliche Besserung des psychischen Zustandes zeigt und eine bedingte Entlassung möglich ist. Eine Überprüfung dazu führen die Gerichte jährlich durch.
Kann ein Angeklagter zurechnungsfähig und trotzdem in den Maßnahmenvollzug eingewiesen werden?
Ja, denn wer unter dem Einfluss einer geistigen oder seelischen Abartigkeit von höherem Grad eine Tat begeht, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist, er aber laut psychiatrischem Gutachten zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war, kann der oder die Beschuldigte zusätzlich zu einer Gefängnisstrafe auch in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Auch wenn die Haftstrafe abgesessen ist, wird der Insasse so lange dort angehalten, bis sich sein psychischer Zustand verbessert hat. Auch überprüfen die Gerichte regelmäßig den Fortschritt. Das betrifft meist gefährliche oder suchtkranke Straftäter.
(APA/Red)





