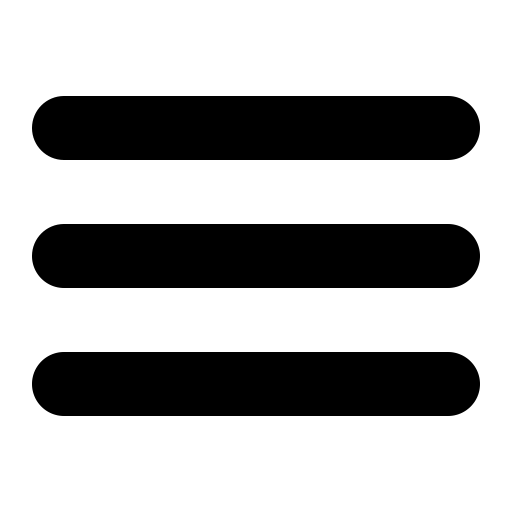Patient an Überdosis verstorben: Freispruch für Arzt in Wiener Neustadt

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft überlegt noch, ob sie den Freispruch akzeptieren soll.Es ging vor allem um den Tod eines jungen Niederösterreichers. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Baden hatte nach einem stationären Drogenentzug den Psychotherapeuten aufgesucht und sich das Drogenersatzmittel Substitol verschreiben lassen. Drei Tage später fand die Mutter ihren Sohn leblos auf dem Rücksitz eines Pkw. Es stellte sich heraus, dass er vom Arzt ein Rezept für insgesamt 90 Kapseln Substitol ausgestellt bekommen und sich eine Überdosis injiziert hatte.
Die Staatsanwaltschaft war der Auffassung, dass der Arzt eine viel zu hohe Dosis verordnet hatte. “Das entspricht nicht den Regeln der medizinischen Kunst” und sei – eben weil der 23-Jährige gerade einen Entzug hinter sich gebracht hatte – “kausal für dessen Tod” gewesen.
Arzt in Wiener Neustadt: Suchtgift bei Patienten
Der Gerichtssachverständige Christian Haring gelangte allerdings zu einer gegenteiligen Auffassung. Man fand im Körper des verstorbenen Patienten “nicht nur das vom Arzt verschriebene Substitol”, sondern Rückstände anderer Suchtgiftmittel, die darauf hinwiesen, dass der 23-Jährige “kontinuierlich Opiate konsumiert hat”. Der Gutachter wies darauf hin, dass die orale Einnahme aller 90 Kapseln (also insgesamt 600 mg Substitol) “nicht tödlich gewesen wäre”. Der junge Mann hatte sich die Ersatzdroge allerdings gespritzt.
Der zweite Anklagevorwurf des Suchtgifthandels konnte – so die Urteilsbegründung der Richterin – “nicht mit der für ein Strafverfahren nötigen Sicherheit” nachgewiesen werden. Mehrere drogenabhängige Patienten hatten behauptet, dass es ein Leichtes gewesen sei, bei dem Psychotherapeuten Drogenersatzmittel zu bekommen. Gegen ein paar Geschenke wie etwa Cognac, Whiskey oder elektrische Zahnbürsten hätte man für fast alles Rezepte ausgestellt bekommen. Man hätte keine Harntests machen müssen, bloße “Blickdiagnosen” hätten gereicht, um an die Ersatzdrogen zu zu kommen.
“Wie sollte der Arzt wissen, dass die Patienten diese Mittel dann am Drogenschwarzmarkt weiterverkauft haben”, stellte die Richterin in den Raum. Sie hielt es für erwiesen, dass der Mediziner seine Patienten sehr wohl gründlich, etwa auf Einstichstellen, untersucht hatte, bevor er Rezepte ausstellte.
(APA)