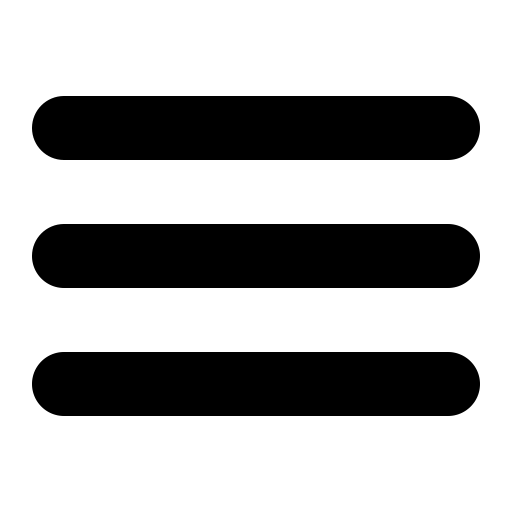In die bizarre Normalität des Abnormalen entführt der österreichische Regisseur Markus Schleinzer mit seinem Debütfilm “Michael”, der seine Premiere im Wettbewerb der 64. Filmfestspiele von Cannes gefeiert hat. Schleinzers Protagonist ist der pädophile Kindesentführer von nebenan, sein Zugang gleicht einer ruhigen, nüchternen Studie – und gerade die Vermeidung der boulevardesken Hysterie hinsichtlich des aufgeladenen Themas macht das Psychogramm eines Missbrauchstäters zu einem verstörenden, kontroversiellen und stark nachwirkenden Filmerlebnis.
Der titelgebende Michael (Michael Fuith) ist einer, den Nachbarn als typischen Durchschnittstypen bezeichnen würden. Er arbeitet für eine Versicherung, bleibt meistens lieber für sich. Wenn er am Abend mit seinen Einkäufen heimkommt, würde wohl niemand vermuten, dass er den Tisch für zwei Personen deckt – und die zweite Person ein zehnjähriger Bub (David Rauchenberger) ist, den Michael im schalldicht ausgestatteten und gut verriegelten Keller gefangen hält. Wie lange dieses unfreiwillige Zusammensein schon besteht, deutet Schleinzer nur einmal anhand eines Briefes an, den das Entführungsopfer seinen Eltern schreibt – und der von Michael schließlich in eine Box mit vielen anderen Briefen gegeben wird.
Vorab bekanntgemacht wurde von dem Film nur, dass es sich um die letzten fünf Monate des gemeinsamen Lebens handelt, was als dramaturgischer Spannungsbogen genügt. Die neutrale bis distanzierte Kamera beobachtet die tägliche Routine der beiden Protagonisten ebenso wie Ausflüge oder Michaels Versuch, einen Spielgefährten für den Buben aufzutreiben. Schleinzer zeigt in kühlen Farben die Banalität des Bösen, erspart dem Publikum dabei aber Bilder des mehrfach implizierten sexuellen Missbrauchs. In Nuancen werden schließlich mit der Zeit leichte Machtverschiebungen in der Kommunikation spürbar, deuten Eindringlinge ein langsames Bröckeln des fast faschistoid geordneten Systems von Michael an.
Es ist ein eindringlicher Film, beklemmend, düster, in seiner teilnahmslosen Beobachtung auch zermürbend. Aber Schleinzer schafft es auch, in diesem Universum Spuren eines absurden Humors unterzubringen, bei dem einem das Lachen immer wieder im Hals steckenbleibt. Es ist erstaunlich, wie stilsicher der Castingdirektor von mehr als 60 Filmen, darunter Michael Hanekes “Das weiße Band”, in seiner ersten Regiearbeit zu wissen scheint, wie viel gezeigt werden muss oder eben nicht. “Ich wollte etwas schaffen, dem man sich aussetzen muss”, wird der 1971 in Wien geborene Schleinzer im Presseheft zitiert. Dass der Einfluss von Haneke dabei eine Rolle spielte, ist nicht zu übersehen.
Schleinzer hat versucht, seriöse Bilder zu finden für ein Thema, das in den vergangenen Jahren von Dutroux bis Fritzl, von Maddie bis Kampusch nur allzu präsent ist in den Köpfen. Dass er aber mit dem Täter im Mittelpunkt eine Identifikationsfigur oder gar einen Helden geschaffen habe, wie mancherorts in einer ersten Reaktion verlautete, greift definitiv zu kurz. Es ist ein beinahe wissenschaftlicher, sezierender Blick, den Schleinzer auf Michaels Welt wirft, mit zwei exzeptionell geführten und spielenden Hauptdarstellern und mit eindrucksvoller formaler Konsequenz.. (APA / VOL Redaktion)