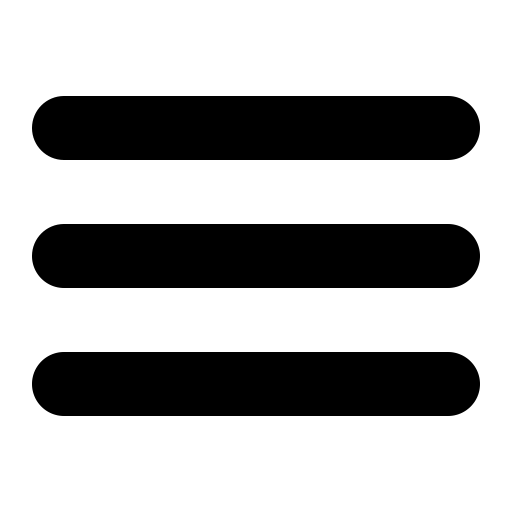Seine Mutter war schwarz und sein Vater weiß: Bob Marley, geboren 1945 in der ländlichen jamaikanischen Gemeinde Saint Ann, wuchs in recht bescheidenen Verhältnissen auf. Später, als Jugendlicher, ging er nach Kingston, um von dort aus mit seiner Stimme und seiner positiven Botschaft die Welt zu erobern. Heute gilt Marley nicht nur als Mitbegründer eines musikalischen Genres, er wird auch mit ungebrochener Begeisterung als Friedenskämpfer verehrt, als Stimme der Unterdrückten, als Revolutionär: ob auf Jamaika, in Afrika, im Mittleren Osten oder in Europa.
“Marley”: Umfassende Hommage an die Reggaegröße schlechthin
Kevin Macdonald, der in seiner Vita Dokumentationen (“Ein Tag im September”) und Spielfilme (“Der Adler der neunten Legion”) vereint, zeigt uns das Geburtshaus der Reggaeikone genauso wie das einzig bekannte Foto von Marleys weißem Vater. Er berichtet von den ersten Hits der “Wailers”, Marleys Frauen – er hatte elf Kinder aus verschiedenen Beziehungen – politischen Unruhen auf Jamaika sowie Bob Marleys Rolle als Friedensstifter und seiner Krebserkrankung. Schier überwältigend, die Menge an Weg- und Lebensgefährten, die Macdonald dazu vor die Kamera holt: Bobs Witwe, Rita Marley, genauso wie Sohn Ziggy und Tochter Cedella Marley, Künstler und Musiker wie Lee “Scratch” Perry oder Jimmy Cliff.
“Marley”, uraufgeführt diesen Februar bei den Filmfestspielen von Berlin, ist so detailreich wie ambitioniert und mit seinen 144 Minuten auch kaum zu lang geraten: Denn freilich gibt es noch weit mehr zu erzählen von Bob Marley und seinem bewegenden Leben; etwa von den tieferen Zusammenhängen zwischen seiner Musik, dem Reggae, und seinem Glauben, der Rastafari-Religion. Stattdessen gibt es zum Ende der Dokumentation Bilder vom sterbenskranken, durch den Krebs gezeichneten Künstler. Dazu O-Töne einer deutschen Krankenschwester, die Marley kurz vor seinem Tod am Tegernsee behandelte.
Bisweilen zwar droht der Mensch Bob Marley im umfang- und aufschlussreichen Interview- und Material-Reigen abhandenzukommen. Die immense filmische Kraftanstrengung von Kevin Macdonald aber gibt allen Anlass zur Bewunderung. Jedwede Annäherung an Bob Marley, der am 11. Mai 1981 mit 36 Jahren starb, muss sich fortan den Vergleich mit Macdonalds Dokumentation gefallen lassen – die zudem von einem kongenialen (bereits auf Island Records veröffentlichten) zwei CDs und 24 Titel starken Soundtrack flankiert wird.
(APA)