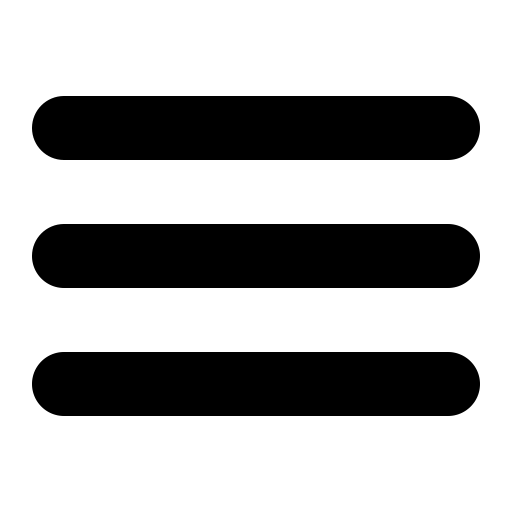Gewaltschutzgesetz - Wo es nicht greift
Das war am 11. September 2003, am Tag, als sie schwedische Außenministerin Anna Lindh ihren Stichverletzungen erlag, die ihr ein zunächst Unbekannter am Vortag in einem Stockholmer Einkaufszentrum zugefügt hatte. Der Mord an der 46-jährigen Politikerin machte weltweit Schlagzeilen. Der Tod der um drei Jahre jüngeren gebürtigen Türkin in Wien ist der Öffentlichkeit nicht mehr in Erinnerung.
Der Ehemann wurde nach den Anzeigen nicht einmal einvernommen, kritisiert Rosa Logar, die Leiterin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, welche die besondere Gefährlichkeit des Täters erkannte. Die Frau hatte sich zu ihren erwachsenen Kindern geflüchtet, die Einstweilige Verfügung, durch die sie Schutz vor ihrem Mann erhoffte, war noch nicht erteilt. In diesem Fall hat das Gewaltschutzgesetz versagt. Das Gesetz ist nicht geeignet zum Schutz vor gefährlichen Tätern und wurde auch nicht dafür geschaffen, sagte Logar. Die Maßnahmen wären ja so, als ob man einen bewaffneten Räuber aus der Bank bitten würde.
Aber wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir Opfer vor gefährlichen Tätern schützen können. 50 Prozent der Tötungsdelikte und der Fälle von schwerer Körperverletzung wären zu verhindern, erklärte die Expertin im Gespräch mit der APA und hat dazu eine Reihe von Vorschlägen parat: Bei Entlassungen aus der nach einschlägigen Vorfällen verhängten U-Haft müssten Fachleute beigezogen werden, welche die Tötungs- und Verletzungsbereitschaft der Verdächtigen beurteilen, denn die vergeht nicht immer von selber.
Dazu gebe es auf der Basis internationaler Studien über Faktoren bei Gewalttätigkeit mehr Know How als angewendet werde, sagte Logar, die auch Staatsanwaltschaften in zu vielen Fällen eine fatale Sicht zuschreibt, wenn zum Beispiel die Wiederholung von Drohungen dazu führt, dass diese nicht mehr ernst genommen werden. Diese sind aber ein Faktor für die Gefährlichkeit, erklärte die Expertin, oft beruhen Fehleinschätzungen auf zu wenig Hintergrund-Information. Zehn Prozent der Opfer, die von der Polizei zu uns überwiesen werden, sind besonders gefährdet.
Sie würde sich spezielle Schulungen in Sachen Gewalt in der Familie für Staatsanwälte und Richter wünschen, wie es sie für die Polizei gibt. Aber unabhängige Richter kann man nicht zur Fortbildung verpflichten. Wichtig wäre ihrer Überzeugung nach mehr Verständnis für die psychosoziale Situation der Opfer, besonders bei Migrantinnen. Als Beispiel führt Logar den Freispruch für einen Mann an, der seine verletzte Frau auf dem Boden festhielt, was vom Richter als türkische Umarmung tituliert wurde.
Wenn sich eine Migrantin an die Polizei wendet und sagt: Mein Mann streitet schon wieder, dann kann durchaus eine Morddrohung im Hintergrund stehen, erklärte Peter Goldgruber von der BPD Wien. Der Ausdruck streiten allein scheint harmlos, aber allein die Tatsache, dass sich die Frau an die Polizei wendet, muss alle Alarmglocken läuten lassen. In Wien kümmern sich die Sicherheitsreferenten der Polizeikommissariate um Gewalt in der Familie, indem sie nach dem Ersteinschreiten durch Uniformierte jeden Fall noch einmal durchgehen, Aussagen hinterfragen und Zeugen einvernehmen. Jeder Fall muss binnen 48 Stunden einer Opferschutzeinrichtung gemeldet werden, die von sich aus Kontakt mit den betroffenen Frau aufnimmt. Rund 70 Prozent der Fälle werden in den größeren Städten registriert, sagte Goldgruber. Das Phänomen Gewalt ist aber sicher kein rein städtisches.
Was Migrantinnen offenbar daran hindert, sich in Sachen Gewaltschutz an die Polizei zu wenden, ist neben mangelnder Kenntnisse von Sprache und Hilfsmöglichkeiten die Tatsache, dass ihr Aufenthaltsrecht oft an das den Ehemanns gebunden ist. Eine Frau, die von Gewalt betroffen ist, kann schon eine eigene Niederlassungsbewilligung bekommen. Sie muss aber über mindestens 690 Euro Monatseinkommen verfügen und über eine ortsübliche Unterkunft. Das sind Hürden. Außerdem ist eine solche Bewilligung auf ein Jahr befristet. Das schwebt dann wie in Damoklesschwert über den Betroffenen, erklärte Logar.