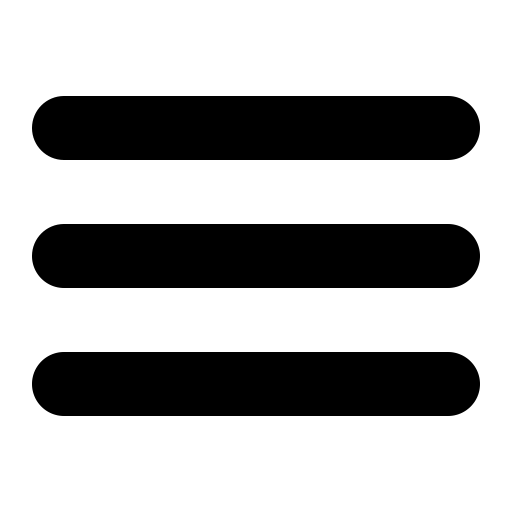EuGH-Urteil zur Familienbeihilfe am Donnerstag

Die Indexierung der Familienbeihilfe war ein Prestigeprojekt der ersten türkis-blauen Regierung unter der damaligen Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP).
Türkis-Blau knüpfte Familienbeihilfe an Wohnort der Kinder
Familienleistungen und Kinderabsetzbeträge für in Österreich arbeitende EU-Bürger wurden an die Lebenserhaltungskosten in dem Land, in dem die Kinder leben, angepasst. Türkis-Blau wollte damit 114 Millionen Euro jährlich einsparen. Laut Anfragebeantwortungen zahlte der Staat im Vergleich zu 2018 im Jahr 2019 62 Mio., 2020 87 Mio. und 2021 141 Mio. Euro weniger aus.
Während man durch die Indexierung für Kinder, die etwa in der Schweiz, Großbritannien oder Irland leben, mehr bekommt, gibt es für Kinder in Rumänien nicht einmal die Hälfte von dem, was ein für ein Kind in Österreich ausgezahlt wird. Kinder in Bulgarien erhalten noch weniger.
Die Indexierung der Familienbeihilfe war von Anfang an umstritten. Argumentiert wurde bei dem Beschluss des Gesetzes in Österreich damit, dass die Lebenserhaltungskosten vom Wohnort abhängig seien. Daher sei es unfair, wenn überall dieselbe Summe ausbezahlt werde. Sowohl die Nachbarländer als auch Europaexperten hielten das Ansinnen schon vor Beschluss mit dem Europarecht für unvereinbar.
EU klagt gegen Familienbeihilfe bei EuGH
Seitens der EU-Kommission hieß es, die Indexierung der Familienbeihilfe sei nicht nur rechtswidrig, sondern auch diskriminierend. Sie gilt nämlich nicht für österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die im Ausland für österreichische Behörden arbeiten und deren Kinder dort mit ihnen leben - "obwohl ihre Situation vergleichbar ist". Die EU-Behörde reichte beim EuGH Klage ein.
Der EuGH-Generalanwalt Richard de la Tour erklärte die Indexierung bereits als unzulässig. Sie verstoße gegen EU-Recht, Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten müssen in Österreich unabhängig vom Aufenthaltsort ihrer Kinder die gleichen Beihilfen und steuerlichen Vergünstigungen wie österreichische Arbeitnehmer erhalten können, hieß es in den im Jänner veröffentlichten Schlussanträgen.
Die Betroffenen würden schlussendlich in gleicher Weise zur Finanzierung des österreichischen Sozial- und Steuersystems beitragen wie österreichische Arbeitnehmer, argumentierte de la Tour. Eine Festsetzung der Höhe der Familienleistungen nach dem Wohnsitz stelle eine Verletzung des Freizügigkeitsrechts dar.
Familienministerium sieht sich auf Rechtsfolgen des Urteils vorbereitet
Diese Schlussanträge sind zwar für Staaten konsequenzenlos und für EuGH-Richter unverbindlich, meistens halten sich die Richter jedoch daran. Sollte das auch am Donnerstag der Fall sein, könnte Österreich Nachzahlungen leisten müssen. Aus dem Familienministerium hieß es dazu, man sei "für alle etwaigen Rechtsfolgen durch das Urteil des Gerichtshofs vorbereitet". Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung im Mai bereits Rückstellungen von 220 Mio. Euro für mögliche Rückzahlungen gebildet.
(APA/Red)