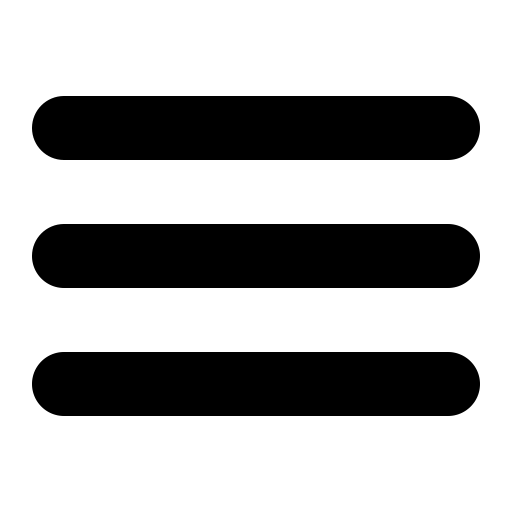Die schwarze Flut ist da
Die „marea negra“ (schwarze Flut) ist da. Das an die Strände gespülte Öl aus dem havarierten Großtanker „Prestige“ bedroht nicht nur die Lebensgrundlage tausender Menschen in der nordwestspanischen Region Galicien, auch das ökologische Gleichgewicht ist in Gefahr. „Was sollen wir jetzt bloß tun?“, schluchzt eine junge Frau aus dem Ort Muxóa in die Fernsehkameras. „Es ist, als nähme man uns das tägliche Brot.“
Die Menschen an der Costa de la Muerte (Todesküste), die ihren Namen den vielen Schiffsunglücken verdankt, leben allein vom Meer. In der Fjord ähnlichen Gegend zwischen Malpica und dem Kap Finisterre, das bis zum 15. Jahrhundert als das „Ende der Welt“ galt, gibt es die besten Meeresfrüchte und Schalentiere Spaniens. Besonders beliebt – und teuer – sind die percebes (Entenmuscheln), die meist von Frauen unter Einsatz ihres Lebens an den schroffen Felsen gesammelt werden. „Damit ist es jetzt aber aus“, klagt eine dieser „Percebeiras“ und deutet auf den Ölschlamm am Fuße der Klippen. Dieser gelangte auch an einige der feinsandigen und einsamen Strände – unter Touristen galten sie bislang als Geheimtipp.
Auch im Fischerdorf Camarinas macht sich Verzweiflung breit. Im kleinen Hafen, wo sonst der Tagesfang von den Booten abgeladen wird, stehen nun große Lastwagen: Sie bringen weitere Ölbarrieren und andere Ausrüstung, um die schwarze Brühe zu bekämpfen. Die Trawler dürfen nicht auslaufen, die Behörden haben den Fischfang bis auf weiteres untersagt. Wie Hohn empfinden viele hier die Worte des Fischereiministers Miguel Arias Canete aus dem fernen Madrid: „Eine Umweltkatastrophe wird es nicht geben.“ „Die Stimmung im Dorf ist wie bei einem Begräbnis“, sagt Manuel Lopez, der sich noch an die vorige Umweltkatastrophe erinnert: Fast genau vor zehn Jahren explodierte vor La Coruna der Tanker „Aegean Sea“ und verseuchte 200 Kilometer Küste.
Ein anderer Fischer meint: „Wenn es soweit kommt, müssen wir eben auswandern.“ Das ist nicht bloß ein Spruch. Im 19. und 20. Jahrhundert trieb die Armut mehr als zwei Millionen Galicier ins Ausland, vor allem nach Lateinamerika. Noch heute ist Buenos Aires mit rund 300.000 Auswanderern die größte „galicische“ Stadt, der größte „galicische“ Friedhof liegt in Havanna. Auch heutzutage emigrieren noch viele junge Leute, um auf den Kanaren oder Mallorca auf dem Bau oder als Kellner zu arbeiten. Angesichts der niedrigen Geburtenrate kämpft Galicien gegen die Entvölkerung: Die Alten bleiben zurück, die Dörfer sterben aus. Die Region ist fast so groß wie Belgien, hat aber nur 2,7 Millionen Einwohner – genau so viele wie vor 50 Jahren.
Das Meeresgebiet, wo sich das Tankerunglück ereignete, gilt aber auch als eines der artenreichsten – und sensibelsten – des Atlantiks:
Papageientaucher, Möwen und Kormorane, Pott-, Schweins-, Finn- und sogar Blauwale sowie elf verschiedene Haiarten sind hier zu finden. Seevögeln und Meeressäugern droht ein qualvoller Tod, wenn sie mit dem giftigen Schweröl in Kontakt kommen. „Das Öl tötet alles, was es berührt“, sagt der Meeresbiologe Victoriano Urgorri. Selbst wenn das Öl sich verfestige und auf den Grund sinke, sei die Langzeitwirkung nicht zu unterschätzen. Die Lokaleitung „La Opinion“ meint: „Man hat uns eine Zeitbombe vor die Tür gelegt.“ Der Chef der Fischer- Genossenschaft des Ortes Laxe, Jose Antonio Toja, resümiert es so:
„Wir bekommen alles Schlechte ab. Schon der Name sagt doch alles: Es ist die Küste des Todes.“