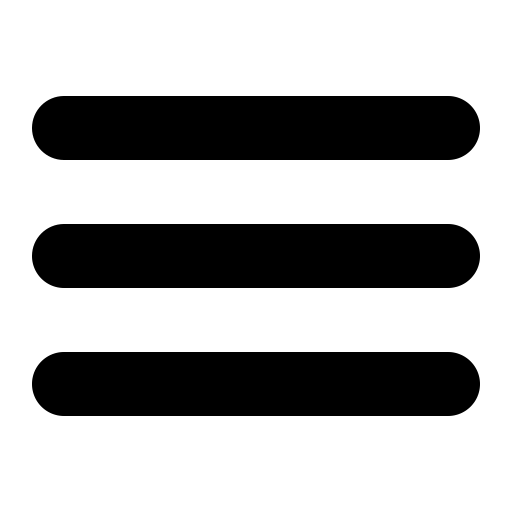Für noch größere Aufmerksamkeit als ohnehin schon vorhanden hatte Tuschis Film “Khodorkovsky” über den ehemaligen Ölmagnaten bereits vor seiner Berlin-Premiere gesorgt: Nach einem Einbruch war vom Regisseur das Original des Streifens als gestohlen gemeldet worden. Mithilfe von Ersatzkopien konnte dieser dann aber doch planmäßig vor zahlreich herbei geströmtem Publikum gezeigt werden. Nach solcherart hochgeschraubten Erwartungen ist das Filmerlebnis ein laues: Keine Enthüllungen werden ausgebreitet, kaum einer der zahlreichen Interviewpartner wird deshalb um sein Leben bangen müssen.
Der deutsche Regisseur mit russischen Wurzeln hat einen Dokumentarfilm in journalistischer Erzählweise geschaffen, ist für die Gesprächsaufnahmen zwischen Moskau, Tel Aviv und London gereist und liefert als Ergebnis umfassender Recherchen einen “Kopfsalat” aneinander geschnittener Interviews. Joschka Fischer kommt ebenso zu Wort wie Chodorkowskis Sohn Pavel, zum Schluss die Titelfigur selbst mit einigen gelassenen Statements in ihrem Einvernahmekäfig im Zuge des zweiten Prozesses.
Nichts erfährt man, was man nicht schon vorher wusste, ahnte oder sich denken konnte. Die bis heute unbeantworteten Fragen – beispielsweise, warum der Gründer des einst mächtigen Yukos-Ölkonzerns trotz warnender Signale in seine Heimat zurückkehrte – bleiben unbeantwortet. “Er war von den Schlimmsten der Beste”, urteilt ein junger Mann, und gibt möglicherweise damit die Meinung vieler seiner Landsleute wieder. Cyril Tuschi hat eine penible Kompilation des Falls geschaffen, die umfassend bis zum Status quo informiert – aber nicht weiter.
Am entgegen gesetzten Ende der sozialen Pyramide hat Rosa von Praunheim – zur Premiere mit rosa Zylinder und langem schwarzem Mantel erschienen – seine Doku “Die Jungs vom Bahnhof Zoo” angesiedelt. Der Titel ist angelehnt an Buch und Film “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo” vor rund drei Jahrzehnten, worin das Mädchen Christiane F. über Drogen und Kinderprostitution in Berlin berichtet. Von Praunheim lässt in seinem Film die Strichjungen rund um den Berliner Bahnhof “Zoologischer Garten” zu Wort kommen.
Ein Ausschnitt aus einer ARD-Reportage der frühen 60er Jahre über die käufliche, homosexuelle Liebe am Bahnhof Zoo gleich zu Beginn des Films macht deutlich, wie sehr sich die Gesellschaft inzwischen gewandelt hat: Von “Schwerkriminalität” und “Perversion” ist da noch die Rede. Der Regisseur hat einige Männer von damals aufgespürt, die sich an ihre Zeit als “Stricher” durchaus auch gerne zurückerinnern. Damals waren es hauptsächlich Deutsche, Türken oder Araber, die “anschaffen” gingen – heute sind es hauptsächlich Rumänen.
In jenem rumänischen Dorf, aus dem viele der Roma-Stricher in Berlin stammen, weiß niemand davon. In erster Linie sei es das schnelle Geld, das junge Männer in finanzieller Notlage zu Strichern werden lässt. Es ließe sich auch eine direkte Linie zwischen Kindesmissbrauch und späterer männlicher Prostitution ziehen, erzählt ein Streetworker über seine Klientel. Der österreichische Regisseur Peter Kern (“Blutsfreundschaft”), 61 Jahre alt, 160 Kilogramm schwer, spricht als Freier im Film. Er sei völlig vereinsamt, sagt er. Und doch wünsche er sich so sehr, dass jemand nur den Kopf an seine Schulter legte. Da dies aber niemand freiwillig mache, müsse er dafür zahlen, dass sich jemand mit einem “Monster wie mir” einlasse. “Für mich sind sie Psychologen und Heiler, die Stricher und Huren”, sagt er.
Auch ein mittlerweile in Wien lebender junger Roma kommt zu Wort. Nazif war als Kind mit seinen Eltern aus Bosnien nach Berlin gekommen, wo ihn seine Eltern sofort zum Stehlen anhielten. Als sie später erfuhren, dass er als Strichjunge arbeitete, wurde er von ihnen brutal misshandelt. Im Gefängnis lernte er Lesen und Schreiben, verfasste ein Buch über seine freudlose Vergangenheit. Nachdem er aus Deutschland abgeschoben wurde, erhielt er in Österreich Asyl. Befragt nach seinen Wünschen, antwortet er bescheiden, es solle so bleiben wie jetzt: “Ruhig, Job – nicht viel.”
Die filmische Auflösung des Themas in den “Jungs vom Bahnhof Zoo” ist wenig abwechslungsreich: Die häufigen gestellten Begrüßungsszenen zur Einführung neuer Protagonisten und ihre von der Stimme aus dem Off begleiteten Gänge durch die Stadt werden nur deshalb nicht langweilig, weil die Männer so packend und offen über ihr Schicksal sprechen.
(Apa)