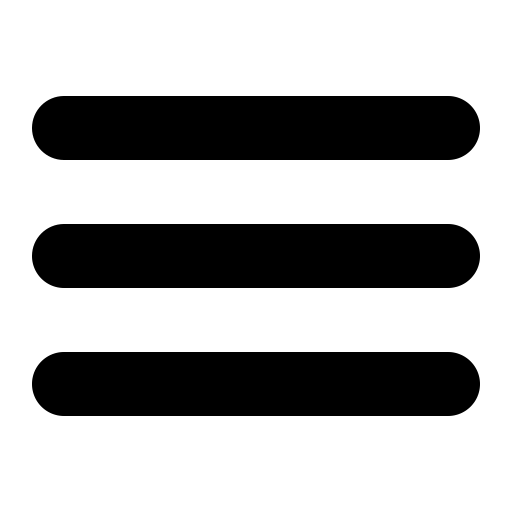Im Monatsnamen Juli ist der Imperator verewigt. Diese Erfolgsgeschichte hat den deutschen Religionswissenschafter Jörg Rüpke auf den Plan gerufen. In seiner im Beck-Verlag erschienen Kulturgeschichte Zeit und Fest geht er der Entstehung des Kalenders nach, der immer wieder die Begehrlichkeiten von Machthabern und Kirchenfürsten geweckt hat.
Vor den Römern lebten die Menschen nach dem Mond, erzählt Rüpke. Da hieß es, beim nächsten Vollmond sehen wir uns wieder. Diese Termine sind auch für Analphabeten einzuhalten und damit zutiefst demokratisch. Der Nachteil: Die Mondphasen ergeben kein vollständiges Jahr. Damit lassen sich keine festen, wiederkehrenden Termine eintragen, etwa für den Kaisergeburtstag oder andere Feiertage. So wandert etwa der muslimische Fastenmonat Ramadan, der sich am Mond orientiert, durch das Jahr.
Für eine Weltmacht wie Rom war diese fehlende Planbarkeit nicht akzeptabel, erläutert Rüpke. Bereits ab dem 4. Jahrhundert vor Christus experimentierten römische Wissenschafter mit dem Sonnenkalender. Ich glaube, dass vor allem die hochspezialisierte Justiz auf einer Reform bestand, um für ihre Verfahren genaue Fristen festlegen zu können.
Als Hauptproblem erwiesen sich die Schalttage, die anfangs zu Schaltmonaten zusammengefasst worden sind. Doch mit diesen Wochen, die in keinem Kalender auftauchten, konnte viel Schindluder getrieben werden, sagt Rüpke. Mancher Politiker hat sie genutzt, um seine Amtszeit zu verlängern. Mit einem Machtwort sorgte Caesar dann für Einheitlichkeit, indem er die Schalttage auf die Monate verteilte und den Februar mit einem flexiblen Tag versah.
Die Praktikabilität des Julianischen Kalenders ist für den Wissenschafter der Hauptgrund für dessen Erfolg. Die Christen haben deshalb auch sofort zugegriffen und dem System ihren Stempel aufgedrückt. Seitdem rechnet die Welt nach Christus und mit Monaten, die nach römischen Kaisern (Augustus) oder Göttern (Mars/März) benannt sind. Wenn in Kulturen noch ein eigener Kalender in Gebrauch ist, etwa in China oder arabischen Staaten, dann gilt er meist parallel zum westlichen Kalender – in einer Art Zweisprachigkeit.
Bereits Caesars Nachfolgern glückte es nicht, ihren Namen nachdrücklich im Kalender zu verewigen. Die alte Tradition setzte sich spätestens nach dem Tod der jeweiligen Imperatoren wieder durch. Ähnlich erging es anderen Reformern wie den französischen Revolutionären. Ihr Kalender folgte einer strengen Logik: zwölf Monate von je 30 Tagen, unterteilt in drei Wochen zu je zehn Tage. Die Monate waren nach Schnee, Regen, Wind, Gras oder Obst benannt. Dieses Modell scheiterte ebenso wie die Versuche der Diktatoren Mussolini oder Hitler, dem Kalender ihren Stempel aufzudrücken.
Seinen globalen Siegeszug bezahlte der Kalender allerdings mit der Auflösung seiner Sinn stiftenden Struktur. Noch sind die Wochenenden grau oder farblich abgesetzt, aber auch damit wird es bald vorbei sein, wenn immer mehr Menschen an diesen Tagen arbeiten müssen, sagt Rüpke. Zurück bleibt dann ein Kalendergerüst, das jeder individuell füllen kann. Diese Ausdifferenzierung ist seit längerem zu beobachten, sagt der Theologe. Heute hat doch schon jede Gruppe ihren eigenen Kalender mit ihren sinnstiftenden Terminen, von den Lehrern über die Frauen und Literaten bis zu den Pfarrern.