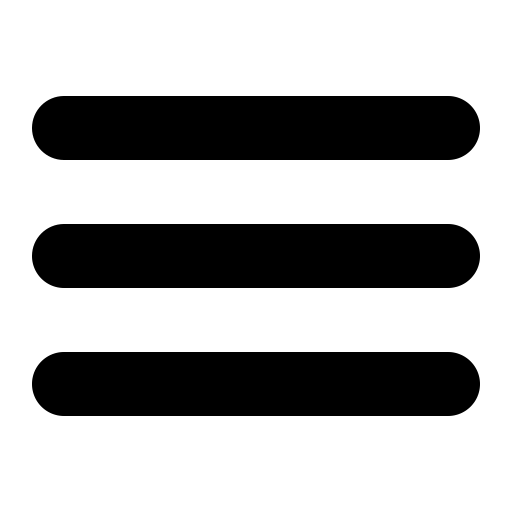In 37 der 50 Bundesstaaten werden sie in Referenden zusätzlich zu Themen befragt, die von Abtreibung über die Homo-Ehe bis hin zur Legalisierung von Marihuana reichen. Insgesamt stehen mehr als 200 Initiativen zur Abstimmung. Mit den Plebisziten über die umstrittenen Themen wollen die Organisatoren mehr Wähler in die Wahllokale locken. Außerdem sorgen die Referenden dafür, dass die Kandidaten für die Kongresswahl Klartext über die heiklen Fragen reden müssen.
Mit Spannung wird etwa das Referendum im Präriestaat South Dakota verfolgt. Dort soll in einer Volksabstimmung ein kürzlich verabschiedetes Gesetz aufgehoben werden, welches Abtreibung nur noch bei einer Gefahr für das Leben der Mutter erlaubt, nicht aber bei Vergewaltigung oder Inzest. In acht Staaten wird darüber abgestimmt, ob in der Landesverfassung ein Verbot der Homo-Ehe aufgenommen wird. In Colorado und Nevada dürfen die Wähler entscheiden, ob Marihuana erlaubt werden soll. In sechs Staaten geht es um die Anhebung des Mindestlohns, und in Kalifornien um die Besteuerung von Ölunternehmen.
In Arizona geht es gar um den Traum vom großen Glück: Zur Abstimmung steht die Einrichtung einer Lotterie, die einem beliebigen, nach dem Zufallsprinzip ausgesuchten Wähler den Gewinn von einer Million Dollar (783.269 Euro) verheißt. Die Initiatoren versprechen sich dadurch eine Erhöhung der Wahlbeteiligung.
Die örtlichen Volksabstimmungen beeinflussen auch die Kongresswahl. Wahlmaßnahmen am Rande können das Kräftegleichgewicht im US-Senat, im US-Repräsentantenhaus und in den Volksvertretungen der Bundesstaaten beeinflussen, sagt Daniel Smith von der Universität Floria. Sie bestimmen, über welches Thema gesprochen wird. Die neben der Kongresswahl laufenden Abstimmungen seien vor allem in Jahren wirkungsvoll, in denen nur ein Teil des Kongresses gewählt wird und kein neuer Präsident, weil sich damit mehr Wähler zur Abstimmung bewegen ließen. Bei der letzten Zwischenwahl vor vier Jahren lag die Beteiligung unter 40 Prozent.
Bei den Wahlinitiativen in den Bundesstaaten kommen die Demokraten vermutlich besser weg als die Republikaner, vor allem wenn es um die Mindestlöhne geht, sagt Kristina Wilfore von der US-Denkfabrik Ballot Initiative Strategy Center. Örtliche Wahlinitiativen könnten entscheidend dafür sein, wie die Wähler für den Senat und das Repräsentantenhaus stimmen. Dieses Jahr sind die Wahlinitiativen mehr denn je ein wesentlicher Teil der Wahlstrategie der Linken, um Macht zurückzugewinnen. Dem Institut zufolge wurden bei der letzten Wahl in den Bundesstaaten fast 400 Millionen Dollar für den Wahlkampf für die örtlichen Initiativen ausgegeben.
Das Gesicht ist den Fernsehzuschauern gerade in Wahlkampfzeiten allzu vertraut. Abend für Abend werben TV-Spots mit Bildern von US-Präsident George W. Bush um Stimmen bei der Kongresswahl am Dienstag. Der Unterschied in diesem Jahr: Bush taucht fast ausschließlich in den Filmchen der oppositionellen Demokraten auf. Seine republikanischen Parteifreunde verstecken ihn, so gut es geht.
In mehr als 90 Spots in 34 Wahlkreisen zeigen Demokraten den Präsidenten, wie US-Medien berichten: Meist ist er darin mit dem jeweiligen republikanischen Gegenkandidaten zu sehen, der durch die Verbindung mit dem unpopulären Präsidenten diskreditiert werden soll. Bushs Beliebtheitswerte liegen derzeit unter 40 Prozent.
Von den 435 republikanischen Kandidaten für das Repräsentantenhaus zeigt nur der Mandatsbewerber LaVar Christensen aus Utah ein Bild von Bush, wie ein Parteisprecher der Washington Post sagte. Den Namen des gegenwärtigen Präsidenten spricht Christensen in dem Spot allerdings nicht aus. Dafür bezeichnet er sich stolz als Republikaner in der Tradition von Bushs Vor-Vorgänger Ronald Reagan. Besonders originell ist der Spot des republikanischen Abgeordneten E. Clay Shaw Jr. aus Florida. Shaw preist darin seine enge Zusammenarbeit mit dem früheren Präsidenten Bill Clinton – einem Mitglied der gegnerischen Demokraten.