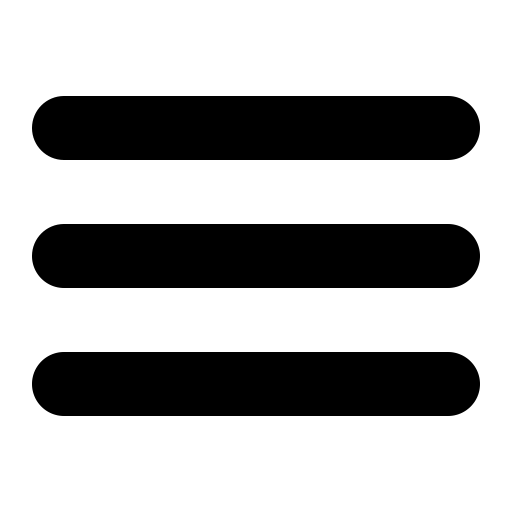Der 39-Jährige wurde im Sinne der Anklage zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Wie schon im ersten Verfahren waren auch diesmal nur fünf der acht Geschworenen davon überzeugt, dass der Angeklagte die 36 Jahre alte Frau vorsätzlich getötet hatte. Drei Laienrichter verneinten die Frage nach Mord. Hätte sich nur einer mehr ihnen angeschlossen, wären die Eventualfragen nach Totschlag und Körperverletzung mit Todesfolge zum Tragen gekommen. Das hätte einen Strafrahmen von ein bis zehn Jahren Haft bedeutet.
Der Pressesprecher war bereits im April zu 18 Jahren verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob im Rechtsmittelverfahren diese Entscheidung aus formalen Gründen auf und ordnete eine Neudurchführung an.
In dieser argumentierte der Pressesprecher nun mit einem so genannten Reflextod: Er habe der Frau auf eine verbale Provokation hin zwar den Arm um den Hals gelegt und zugedrückt. Er habe sie allerdings nur eine halbe Minute in den Schwitzkasten genommen, sei dann mit ihr gestürzt und habe keine Gewalt mehr ausgeübt. Durch das Anschlagen kann es beim zu Boden Stürzen zu einem Kreislaufzusammenbruch kommen, meinte sein Verteidiger unter Berufung auf ein rechtsmedizinisches Lehrbuch.
Der Gerichtsmediziner Johann Missliwetz schloss diese Version allerdings aus. Es habe kein kurzfristiger Todeskampf, sondern ein mindestens dreiminütiger Würge-Akt stattgefunden, sagte der Gutachter. Der 36-Jährigen wären das Zungenbein und Knorpel in Kehlkopfbereich gebrochen worden. Sie habe außerdem massive Stauungsblutungen im Gesicht aufgewiesen, was ebenfalls auf eine heftige Gewalteinwirkung hindeute.
Um den geltend gemachten Reflextod beweisen zu können, hatte die Verteidigung am Freitag die Beiziehung eines Neuropathologen beantragt, um diesen das Gehirn und die Carotisgabel des Opfers untersuchen zu lassen. Das wurde vom Gericht abgewiesen: Einerseits handle es sich dabei um keinen direkten, sondern einen Erkundungsbeweis, der auf einer Hypothese beruhe. Andererseits wären die Beweismittel nicht greifbar, hieß es in der Begründung.
Wie Manfred Hochmeister von der Wiener Dependance für Gerichtsmedizin darlegte, dürfte nämlich das Asservat mit dem Gehirn der Toten verschwunden sein. Im Rahmen der Obduktion der Leiche habe er dieses in einem Fläschchen verwahrt. Asservate werden in Mordfällen normalerweise bis zum rechtskräftigen Abschluss der Gerichtsverhandlung in einer so genannten Asservatenkammer aufbewahrt.
Laut Hochmeister soll das Fläschchen jedoch zunächst überhaupt weg gewesen und schließlich an einem falschen Ort aufgetaucht sein. Da habe sich aber das Gehirn nicht mehr darin befunden, sagte Hochmeister in seiner Funktion als beigezogener Sachverständiger.