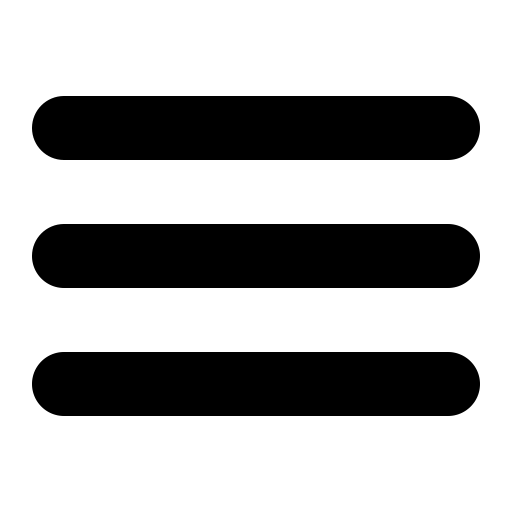Gewalt gegen Frauen: Helfer in Wien bereits am Limit

Die Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie werden derzeit einmal mehr an ihre Grenzen gebracht. "Wir haben sehr viele und wirklich schwere Fälle mit Opfern im Spital, die wir besuchen", berichtete Geschäftsführerin Rosa Logar im APA-Gespräch Anfang Februar. Es fehle an Ressourcen für adäquate Betreuung, kritisierte die Expertin.
Mehr Gewaltfälle während der Schulzeit
Zeitliche Häufungen von Gewalttaten an Frauen gibt es übers Jahr immer wieder, die Ursachen dafür seien nicht immer erklärbar, so Logar. Während der Schulzeit betreut die Interventionsstelle generell mehr Fälle, sowie auch Ende Dezember und ab dem Jahresbeginn. "Zu Weihnachten wird oft noch versucht, den Frieden zu wahren, aber nach den Feiertagen geht es richtig los", schildert Logar. "Wir sind sieben Tage in der Woche da und müssen bei jedem Fall, den wir bekommen, sofort tätig werden."
Zuletzt waren es rund 5.800 Fälle im Jahr. "Für die Betreuung jeder Betroffenen bleiben im Durchschnitt nur fünfeinhalb Stunden Zeit", führte Logar, selbst diplomierte Sozialarbeiterin, aus. "Aber auch in drei oder vier Wochen löst man das Problem nicht". Für eine Verhinderung von Gewalttaten sei eine so kurze Betreuungszeit bei weitem zu wenig. Und Gewaltprävention sei nicht sinnvoll, wenn die Betreuung "nur wie die Feuerwehr ist. Es wird nicht an die Wurzel des Problems gegangen", kritisierte Logar. Bei der Hälfte der Gewalttaten gebe es eine Vorgeschichte - Hilfe würde ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gebraucht.
Ressourcen am Limit
"Wir brauchen mehr Ressourcen, um die Leistung zu erbringen", fordert Logar. Um rund 280 bis 300 Fälle kümmert sich jede einzelne Beraterin der Interventionsstelle pro Jahr. Die Anforderungen steigen: Die Fälle würden nicht weniger, 2019 habe es außerdem eine größere Zahl an schweren Gewalttaten und Mordfällen gegeben - die Ressourcen aber seien gleich geblieben. Kommen bei ohnehin knappen Mitteln vermehrt schwere Fälle dazu, die "sehr viel Zeit und Energie" benötigen, seien eben auch die Mitarbeiterinnen irgendwann gesundheitlich an ihren Grenzen angelangt und die Qualität der Betreuung leide. "Das geht so nicht im sozialen Gesundheitsbereich." Zumindest eine Verdoppelung der Mittel wolle man erreichen, meinte Logar, "das wären zwei Millionen mehr. Dann hätten wir für jede Gewaltbetroffene zumindest zehn Stunden".
"Kinderbetreuung ist Präventionsarbeit"
"Ein großes Anliegen an die Politik wäre uns auch, dass wir endlich Kinderbetreuung anbieten können", betonte Rosa Logar, die Leiterin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, im Gespräch mit der APA. Nicht nur seien Kinder, die Gewalt erlebt haben, schwer belastet - ihre Betreuung "ist auch ganz wichtige präventive Arbeit, um die Gewaltspirale zu durchbrechen".
Kinder, die Zeugen von Gewalt waren, sind später oft selbst Täter bzw. Opfer. So berichteten gewaltbetroffene Frauen, die in der Interventionsstelle betreut wurden, dass sie schon als Kinder mit ihren Müttern dort gewesen sind, schilderte die Expertin. "Kinder haben nicht die Möglichkeit, so ein Verhalten zu reflektieren."
Die "Istanbul-Konvention" des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, die Österreich 2013 ratifiziert hat, sehe eine ausreichende Unterstützung eigentlich verpflichtend vor. Genauso gebe es Bekenntnisse im neuen Regierungsprogramm. Eine Erleichterung der Situation durch das noch von der ehemaligen türkis-blauen Regierung initiierte "Gewaltschutzpaket" sei bisher jedenfalls nicht spürbar, meinte Logar. Neue Mittel seien gar nicht geschaffen worden. Dazu kämen Umstände, die man dringend korrigieren müsste.
Weniger Hilfe für Stalking-Opfer
So bekommen etwa Stalking-Opfer nun keine proaktive Hilfe mehr, kritisierte die Expertin. Mit dem neuen Annäherungsverbot sei sogar eine "paradoxe juristische Situation" entstanden: "Bei einer Annäherung, die durch das Opfer geschieht, etwa wenn ein Kind, das aus der Schule kommt, unbewusst in Richtung des Gefährders geht, der dort einfach steht und wartet, macht sich dieser nicht strafbar", erklärte Logar. Auch die Möglichkeit eines "Antrags auf Ausnahme des Annäherungsverbots" durch den Gefährder habe es zuvor nicht gegeben. Dieser Antrag kann bei der Polizei eingebracht werden, die dann prüft und eine Entscheidung trifft. "Das Opfer wird zwar befragt, darf aber nicht entscheiden", kritisierte Logar. "Allein der Antrag selbst beunruhigt die Betroffenen."
Das wichtige Instrument der Fallkonferenzen (MARAC) zum Schutz von besonders gefährdeten Opfern gebe es zwar noch, die nun dafür verantwortliche Polizei berufe allerdings viel weniger Termine ein als zuvor, merkte Logar an. "Im Jänner hat es heuer nur eine gegeben, bei Hunderten Fällen. Das ist für uns unverständlich." Im "alten" System seien es monatlich zwei oder drei gewesen. Diese Methodik wünsche man sich wieder. "Es müsste eigentlich eine Landeskommission geben, die mit sich wiederholenden Fällen befasst ist."
(APA/red)