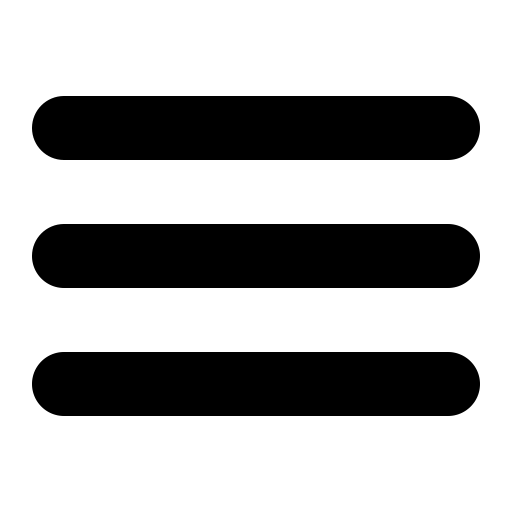Von Johannes Hofer/NEUE
Des Öfteren ist zu hören, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt. Können Sie das bestätigen?
Jan di Pauli: Es ist gesichert, dass die Zahl der Krankschreibungen und Frühpensionierungen aufgrund psychischer Erkrankungen rasant gestiegen ist. Ob das mit einer echten Zunahme an Krankheitsfällen zu tun hat, ist allerdings umstritten. Bei praktischen Ärzten, aber auch bei der Bevölkerung hat sich die Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen erhöht, womit gleichzeitig die Scham, darüber zu berichten oder sich Hilfe zu suchen, gesunken ist. Das heißt, was früher oft etwa unter Rückenleiden oder Bauchschmerzen lief, wird als das benannt, was es tatsächlich ist: beispielsweise eine Depression oder Angststörung. Trotzdem gibt es Faktoren, die vermuten lassen, dass psychische Erkrankungen zunehmen.
Was für Faktoren sind das?
Di Pauli: Beispielsweise das steigende Alter der Bevölkerung. Da geht es nicht nur um Demenz – ganz offensichtlich nimmt im Alter auch das Risiko zu, ein krisenhaftes Ereignis zu erleben. Mit 30 ist das Risiko, Witwe zu werden, natürlich viel geringer als mit 70. Zudem kommen immer mehr Menschen in Pension. Auch das ist ein Ereignis, das eine Depression auslösen kann.
Obwohl sich vermutlich nicht wenige Menschen auf die Pensionierung freuen.
Di Pauli: Egal, ob traurig oder freudig, im Grunde birgt jedes Ereignis, welches den Lebenslauf einschneidend verändert, das Risiko, eine psychische Störung, insbesondere eine Depression auszulösen. Natürlich sind traurige Vorfälle gefährlicher, aber auch freudige Ereignisse, wie eheliche Versöhnung, Geburt eines Kindes oder eben die Pensionierung, sind relativ weit oben auf dieser Skala.
Unter dem Strich haben Sie als Psychiater also mehr zu tun. Sind psychische Erkrankungen dabei weniger stigmatisiert als früher?
Di Pauli: Durchaus. Vor 15 Jahren hätte es das nicht gegeben, dass sich ein erschöpfter Projektmanager selbst einweist. Heute kommt so was vor. Viele junge Menschen informieren sich im Internet vorab, melden sich dann hier und würden dann gleich schon eine Therapieempfehlung für sich selbst mitbringen (schmunzelt). Bei einer differenzierten Betrachtung stellt sich allerdings heraus, dass das Verständnis für Depression oder etwa Angststörungen gestiegen ist, das Verständnis für Psychosen (Anm., siehe Lexikon) oder Suchterkrankungen dagegen eher geringer wird.
Woran liegt das?
Di Pauli: Bei den Abhängigkeitserkrankungen neigen viele dazu, zu sagen, die Betroffenen sind selber schuld. Die psychotischen Erkrankungen sind den Menschen unheimlicher als früher. Früher wurden diese Erkrankungen vermehrt sozial erklärt, nach dem Prinzip: Die schlechten Umstände sind schuld. Heute werden Psychosen tatsächlich als Krankheit gesehen, was ja eigentlich auch beabsichtigt war. Das macht sie aus allgemeiner Sicht jedoch offensichtlich wieder bedrohlicher.
Mit welchen Erkrankungen haben Sie am häufigsten zu tun?
Di Pauli: Das sind die Abhängigkeitserkrankungen und die affektiven Erkrankungen, die Depressionen.
Wie viele Menschen sind von einer psychischen Krankheit betroffen?
Di Pauli: Schätzungen zufolge leiden innerhalb eines Jahres knapp 28 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal an einer psychischen Erkrankung. Das kann natürlich eine Person öfter betreffen, viele andere wiederum gar nicht.
Gibt es regionale Unterschiede bei der Zahl der Erkrankungen?
Di Pauli: In den westlichen Ländern ist die Zahl eigentlich konstant. Da macht es keinen Unterschied, ob ich in Vorarlberg oder Norddeutschland lebe. Wobei doch gewisse Faktoren in der Wohnumgebung positiv oder negativ auf die Menschen einwirken. Es wurde etwa festgestellt, dass in sehr urbanen Gegenden, mit wenig Grün und viel Grau, tendenziell mehr Menschen depressiv erkranken. In diesem Sinn ist die Lage in Vorarlberg sicher besser als anderswo.
Sind Männer oder Frauen häufiger betroffen?
Di Pauli: Dies hängt von der Art der Erkrankung ab. Beispielsweise ist die Geschlechterverteilung bei der Schizophrenie in etwa gleich, an einer Depression erkranken Frauen mit einem Verhältnis von 2:1 deutlich häufiger als Männer. Auch von den Essstörungen sind Frauen wesentlich häufiger betroffen.
Wie beurteilen Sie die Kapazitäten in der Psychiatrie hierzulande?
Di Pauli: An und für sich sind wir hierzulande gut aufgestellt. Es gibt viele psychosoziale Vereine, wie aks, ifs oder pro mente, die gute Angebote haben. Außerdem gibt es hierzulande viele niedergelassene Psychiater. Ein Thema, das uns hier im Krankenhaus immer wieder beschäftigt, sind jedoch die Wartezeiten draußen. Wenn wir jemanden entlassen, ist die Behandlung ja nicht abgeschlossen – 90 Prozent der Patienten brauchen eine Nachbetreuung. Diese sollte eigentlich nahtlos sein, und dafür sind die Wartezeiten schlichtweg zu lang.
Wie ist da der Durchschnitt?
Di Pauli: Der wird leider nie erhoben. Allerdings müssen die Patienten bis zu vier Monate warten. Die Zeit versuchen wir dann durch eine ambulante Nachkontrolle in Rankweil zu überbrücken, was aber eigentlich nicht unsere Aufgabe ist.
Gesundheitslandesrat Christian Bernhard hat in einem Interview zu Jahresbeginn erwähnt, dass ihm die Modernisierung des Landeskrankenhauses Rankweil ein Herzensanliegen wäre. Wie sehen Ihre Wünsche aus?
Di Pauli: Das Gebäude ist aus den Siebzigern, das entspricht nicht mehr den Anforderungen eines modernen Krankenhauses. Ein Neubau wäre notwendig – dazu gibt es auch bereits ein Modell. Ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen beim Land bald zur Umsetzung entschließen.
Wir haben hauptsächlich über die Erwachsenenpsychiatrie gesprochen. Wie haben sich die Geronto- (Anm., siehe Lexikon) und Kinderpsychiatrie in den vergangenen Jahren entwickelt?
Di Pauli: Die Kinderpsychiatrie ist stark ausgelastet. Das liegt auch daran, dass es sie in der jetzigen, vollausgebauten Form erst seit etwa zwei Jahren gibt. Auch da müsste – Stichwort Neubau – räumlich erweitert werden. Gerade im Bereich der Ambulanz. Auch die Gerontopsychiatrie ist gut ausgelastet, da ist allerdings viel getan worden. Es gibt nun auf regionaler Ebene das Case Management für Patienten, die von Demenz getroffen sind. Ich denke, das hat zu einer gewissen Erleichterung geführt.
Welche Herausforderungen sind in der Zukunft zu bewältigen?
Di Pauli: Eine ständige Herausforderung liegt in der Vernetzung nach außen hin, mit den niedergelassenen Ärzten und den psychosozialen Vereinen. Damit eine sogenannte Drehtür-Psychiatrie vermieden werden kann. Sprich, dass jemand nach einem stationären Aufenthalt entlassen wird und gleich wieder hier in Rankweil aufgenommen werden muss, weil die Anbindung nicht optimal war.
Sie sprechen wieder die zu langen Wartezeiten an?
Di Pauli: Genau, aber es geht um mehr als das. Wir müssen auch den Patienten auf das Angebot außerhalb der Psychiatriestation vorbereiten. Beziehungsweise die niedergelassenen Kollegen darüber informieren, was sie erwartet, welche Problematik vorliegt und was die betroffene Person braucht. Das bedeutet natürlich immer einen gewissen Aufwand, der allerdings geleistet werden muss.
Kürzlich hat der fehlende Ärztenachwuchs im Bereich der Kinderonkologie zu einiger Aufregung im Land geführt. Wie ist die Lage in dieser Hinsicht bei den Psychiatern?
Di Pauli: Eine schwierige Frage. Wenn Sie vor acht Monaten gefragt hätten, hätte ich gesagt: katastrophal. Jetzt sind genug junge Ärzte da, wobei noch nicht sicher ist, wie viele davon wirklich Psychiater werden. Im stationären Bereich können wir durchaus noch Fachärzte gebrauchen. Jedenfalls bin ich derzeit wieder deutlich optimistischer. Maßnahmen wie Werbung für den Beruf und die Gehaltsreform greifen jetzt. Mal sehen, wie substanziell das ist.
Woran lag das offenbar geringe Interesse?
Di Pauli: Die Psychiatrie ist nicht das gefragteste Fach unter den Ärzten. Es braucht einen relativ langen Atem. Zudem ist jede Depression anders, jeder Patient individuell zu betrachten. Das macht den Job einerseits interessant, bedeutet andererseits jedoch, dass man sich als Arzt jedes Mal individuell einlassen muss. Und natürlich ist die Psychiatrie nicht das Richtige für jemanden, der eher handwerklich oder technisch interessiert ist.